Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
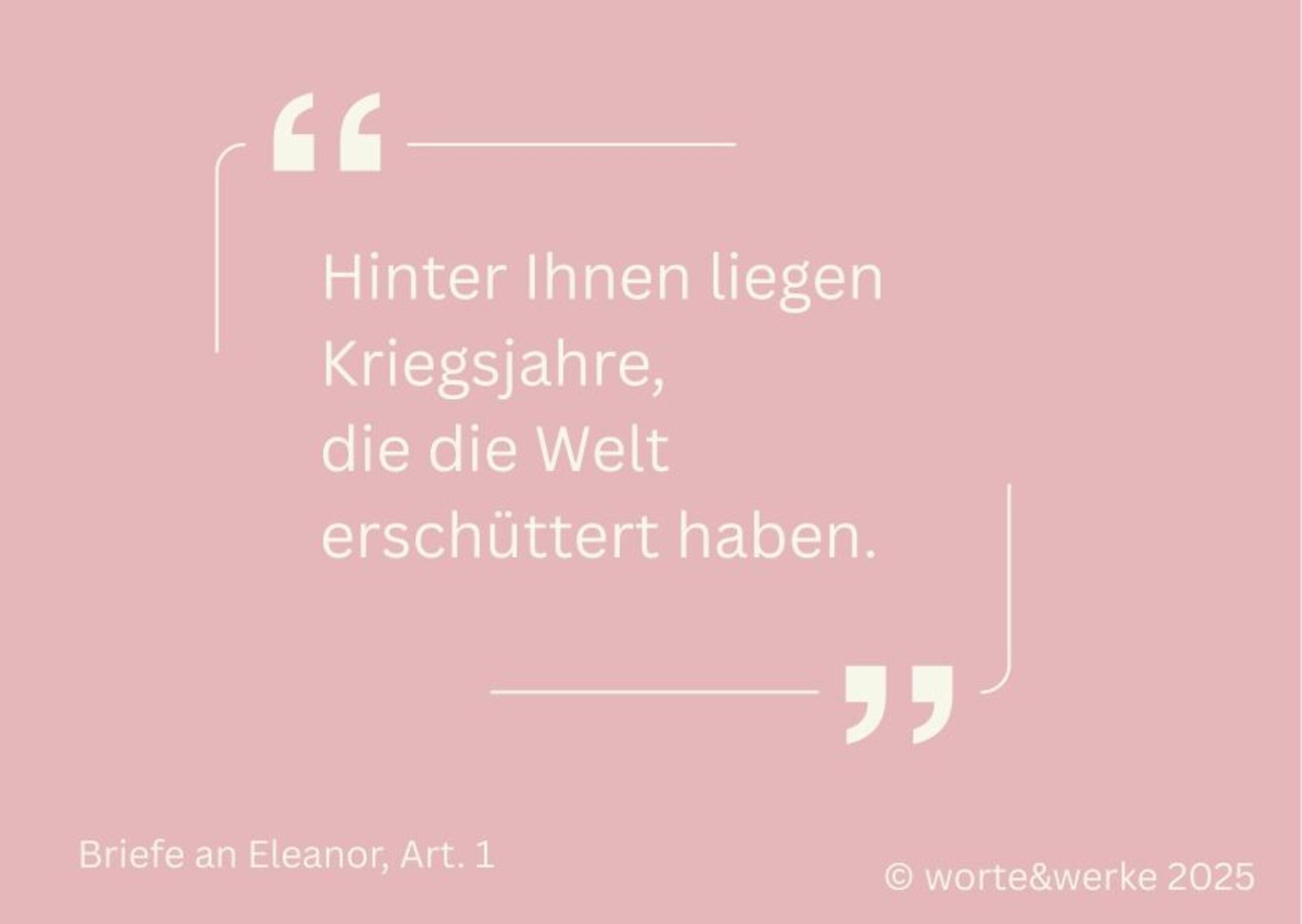
Verehrte Mrs. President,
Ich möchte Ihnen danken.
Knapp 77 Jahre nach der Veröffentlichung der Allgemeinen Menschenrechte der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 sitze ich hier im Norden Deutschlands auf meiner Gartenterrasse und lese die Geschichte der Entstehung der Menschenrechtserklärung. Ich bin tief beeindruckt. Wie haben Sie das mit Ihrer Kommission geschafft, diese 30 Menschenrechte aus einer Vorlage von 408 Seiten zu destillieren?
Sie werden sehr achtsam und wertschätzend um jedes Wort gerungen haben. Ich kann es in der Klarheit Ihrer Formulierungen spüren. Vermutlich liegt es an dem Gegenstand, den Sie miteinander verhandelt haben: Die Rechte der Menschen. Ein Ideal, ein Wunsch, ein Traum – oder soll ich sagen: eine Sehnsucht. Vermutlich haben Sie schon an diejenigen gedacht, die nach Ihnen eine gesellschaftliche und politische Verantwortung übernehmen würden. Und an die, die in diese Welt geboren, in ihr lieben und leben werden.
Hinter Ihnen liegen lange Kriegsjahre, die die Welt verbrannt und die Menschlichkeit erschüttert haben. Gerade einmal zweieinhalb Jahre ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, aber die Nachwehen sind noch zu spüren. Und dann schreiben Sie solch eine Erklärung. Ich bekomme eine Gänsehaut, während ich Ihnen das schreibe.
Ich danke Ihnen. Und ich gratuliere Ihnen. Denn bis heute hat die von Ihnen verfasste Erklärung einen hohen Stellenwert im Ringen um soziale und gesellschaftliche Entscheidungen. Sie ist eine gute Orientierung bis ins 21. Jahrhundert hinein und ich hoffe auch darüber hinaus. Mittlerweile wurden die Menschenrechte in über 460 Sprachen übersetzt und einige Gedanken sind in bindende internationale Abkommen eingeflossen.
Ich habe lange überlegt, ob ich es wage, Ihnen zu sagen, woran das liegen kann. Und ich traue mich, weil es mich sehr berührt. Es liegt an diesem einen Wort, das in Artikel 1 zu finden ist.
Würde
– was für ein in Vergessenheit geratenes Wort. Heute kann es sich kaum Gehör verschaffen, neben Worten wie „Arbeitskraft“, „Gesellschaftsrelevanz“… Und nicht zu vergessen: die immer wieder neu gewählten „Worte des Jahres“. - Ja, so etwas machen wir seit 1971 J - Zuletzt gab es das „Ampel-Aus“ (2024), den „Krisenmodus“ (2023) oder die „Zeitenwende“ (2022). Letzteres wurde gewählt, nachdem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte, der Europa bis heute in Atem hält.
Täglich sehen wir in Deutschland Bilder von Zerstörung und menschlichem Leid.
Unsere Welt ist in eine so bedrohliche politische Schieflage geraten, dass „die Würde“ von marginalisierten Gruppen wegzurutschen scheint. Beim Hinsehen und Hinhören dreht sich mir manchmal der Magen um. Ich erspare Ihnen weitere Beispiele.
Und trotzdem gibt es sie auch heute: Die Menschen, die aufstehen und sich empören, wenn andere erniedrigt, beleidigt, kleingeredet werden. Menschen, die etwas von Ihnen, verehrte Mrs. President und Ihrer Kommission, weitertragen: Diese Gewissheit – oder soll ich es Glauben nennen, dass jeder Mensch eine eigene Würde besitzt, weil wir alle Ebenbilder Gottes sind. Lassen Sie es mich etwas emotional schreiben: Jede/r ist ein wunderbares, von Gott angesehenes Mitglied der Familie Mensch. Und niemand, wirklich niemand, soll übersehen werden.
Ich schreibe Ihnen als Mitglied einer Evangelischen Kirche in Norddeutschland. Wir glauben diesen Satz, aber – um ehrlich zu sein – auch wir haben manchmal Mühe ihn zu leben. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich danke Ihnen für das Erinnern, verehrte Mrs. President. Das Erinnern an die Würde.
Es hat einige Menschen in meinem Dorf ermutigt, einen Park mit den Menschenrechten zu beschildern. Das ist ein guter Anfang. Viele in unserem Dorf werden es lesen. Da bin ich mir sehr sicher. Und das fühlt sich richtig an. Ich wünsche mir sehr, dass es eine Veränderung bewirkt.
Wenn ich darf, schreibe ich Ihnen noch weitere Briefe.
Es wäre mir eine große Freude und Ehre, wenn Sie diese in ihren Händen halten und lesen.
Mit respektvollem Gruß
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 2
Jeder Mensch hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
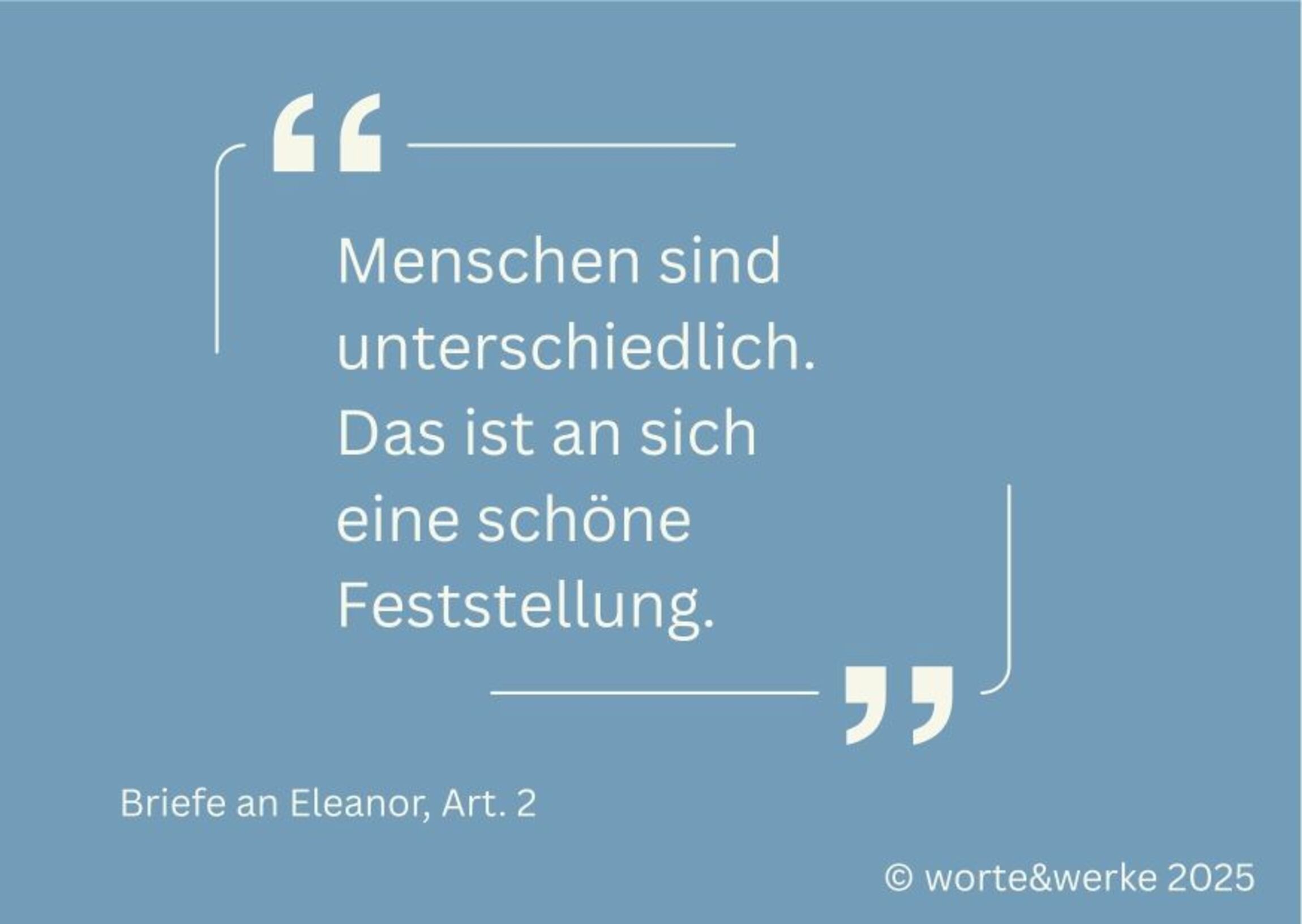
Sittensen, den 21.06.2025
„Ohne jeden Unterschied!“ – Ich lese diese drei Worte immer wieder. Sie berühren mich in besonderer Weise. Sie, verehrte Mrs. President, berühren mit diesen Worten sehr.
Natürlich sind Menschen sehr unterschiedlich. Sie schreiben es ja selber: verschieden in Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Überzeugung. Ich füge – bitte sehen Sie mir das nach – noch hinzu: Menschen sind unterschiedlich im Blick auf ihre soziale Herkunft, berufliche Bildung, sexuelle Orientierung und vieles mehr.
„Ohne jeden Unterschied!“ – Bis heute eine schwierige Aufgabe. Ich schreibe Ihnen ja als Europäerin, die in Deutschland lebt, und ich traue mich kaum zu berichten, was gerade in unserem Land und in anderen europäischen Ländern vor sich geht.
Ja, wir nehmen wahr: Menschen sind unterschiedlich. Das an sich ist eine schöne Feststellung. Was ist das für eine Bereicherung und für ein Glück, dass nicht alle Menschen gleich sind. Ich denke an die Vielfalt der Berufe, die aufgrund unterschiedlicher Begabung erlernt und ausgeübt werden können. Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn es nur Personalsachbearbeiter und keine Handwerker in unserem Land gäbe – und natürlich ist es sehr wichtig, dass wir Personalsachbearbeiter in unseren Firmen landauf landab haben. Ein wirklich ehrenwerter Beruf. Wer sollte sonst den Überblick über all die behalten, die in einer Firma arbeiten, die Krankmeldungen festhalten, die Löhne überweisen. Aber wir benötigen in unserer Gesellschaft die Unterschiedlichkeit von Berufen, weil so unsere Gesellschaft als eine sich gegenseitig unterstützende Gemeinschaft funktioniert. Es gibt diejenigen, die sich um die alten Menschen kümmern und diejenigen, die die Kinder im Blick haben. Mit einem wohlwollenden Blick auf unserer Gesellschaft geschaut, könnte man sagen: Ist doch alles ok.
Aber das ist es eben nicht. In den letzten Jahren nehmen die Spannungen in unserer Gesellschaft zu. Gerade queere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund werden mehr und mehr Opfer der Intoleranz anderer. Ich kenne pflegende Eltern und auch Menschen mit Behinderungen, denen es mehr und mehr an dem notwendigen Support fehlt, wenn es um Beratung und Unterstützung durch Behörden geht. Es gilt sich in einem Paragraphendschungel zurecht zu finden. Und das ist für die Betroffenen oft zum Verzweifeln. Gibt es also doch Unterschiede?
„Ohne jeden Unterschied!“ – Die Frage, die wir uns heute stellen sollten, lautet: Wie können wir uns von Intoleranz und Überheblichkeit verabschieden? Wie können wir uns dagegen auflehnen und unsere Stimme erheben, wenn Witze über queere Menschen, Geflüchtete oder Menschen aus benachteiligten Gruppen gemacht werden?
Verehrte Mrs. President, ich halte es für ein großes Geschenk, zu dieser Zeit in Europa zu leben. Auch wenn wir uns in einer sehr unruhigen Zeit befinden, haben wir gegenüber den Menschen, die in Kriegsgebieten leben, oder sich traumatisiert auf die Flucht begeben, große Vorteile. Abends schlafen gehen können ohne Angst, den nächsten Tag aufgrund eines Drohengriffs nicht erleben zu können. Genug zu essen zu haben. In Gaza findet gerade eine der größten humanitären Katastrophen statt.
Und immer wieder ist da dieses Erschrecken, über Ideen, die in unserem eigenen Land laut ausgesprochen werden. Als Beispiel nur diese für mich fassungslose Forderung einer demokratisch gewählten Partei: Da sollen Geflüchtete in Zukunft von medizinischer Versorgung ausgeschlossen werden, weil sie bisher nicht in die Krankenkassen eingezahlt haben. Erst mal nur eine Idee zur Entlastung des Systems. Bei genauerem Hinsehen werden hier Menschen diskriminiert und ausgeschlossen.
„Ohne jeden Unterschied“ - sehr verehrte Mrs. President. Müssen wir Menschen erst wieder ein ähnliches Schicksal wie das des Zweiten Weltkrieges erleiden, um zu begreifen, dass alle Menschen zwar verschieden, aber dennoch gleichwertig sind in Würde und Ansehen vor dem Gesetz und vor ihren Mitmenschen? Ich hoffe es nicht und ich bete um ein Umdenken und Veränderung in den Köpfen jener, die andere ausgrenzen und abwerten. Damit sie verstehen, dass alle Menschen, ohne jeden Unterschied, gleichwertig sind
Von Herzen danke ich Ihnen, dass Sie meinen Brief gelesen haben.
Hochachtungsvoll
Ihre C. Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
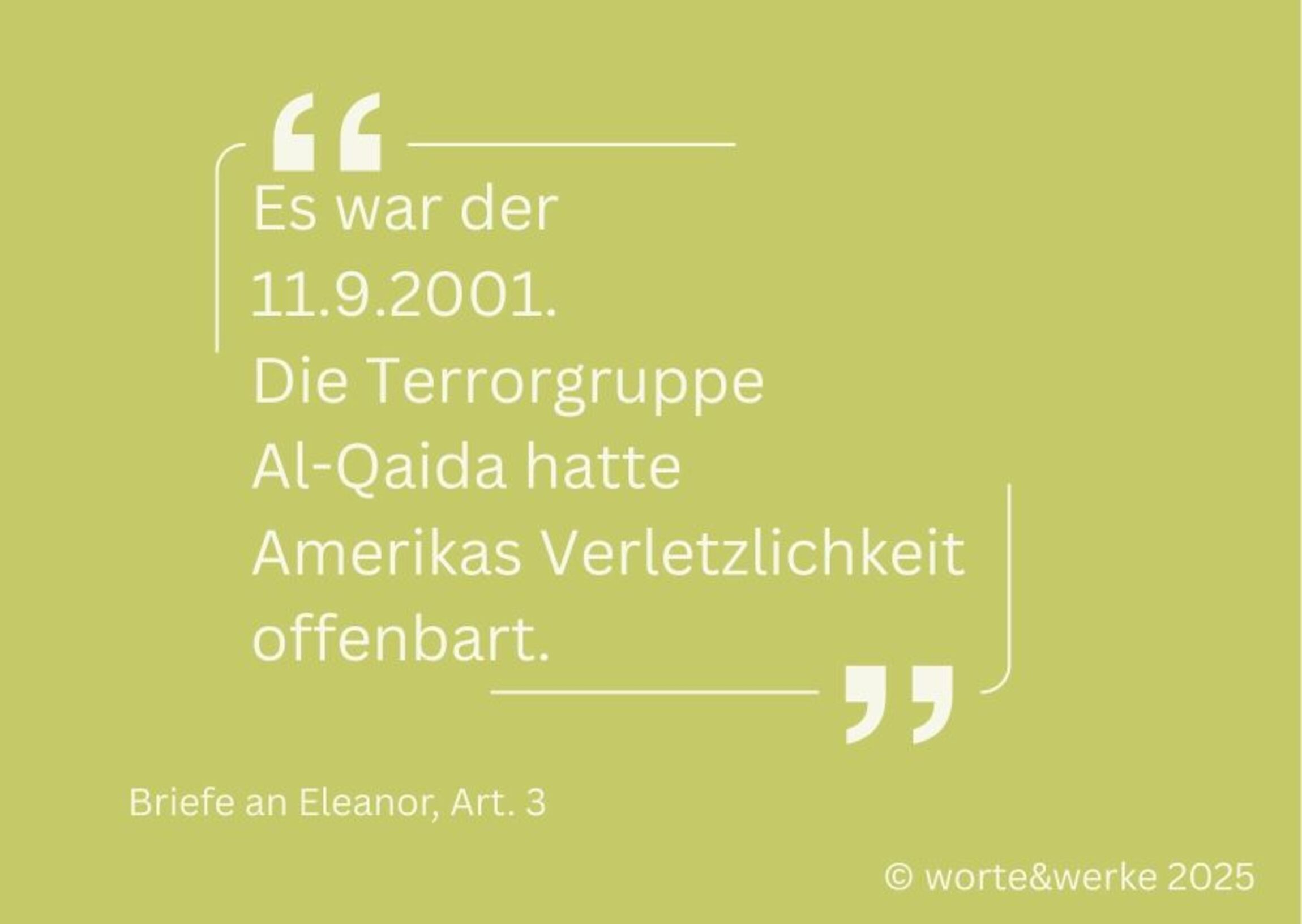
Sittensen, den 28.06.2025
Verehrte Mrs. President,
von meinem Arbeitsplatz schaue ich über das Flachdach eines Hauses gegenüber direkt auf die Felder am Rand unseres Dorfes. Ich genieße diesen Ausblick jeden Tag. Manchmal folge ich mit meinem Blick den landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Feld. Das ist kein Wunder, da ich ja auf einem landwirtschaftlichen Betrieb lebe – vielleicht habe ich das noch gar nicht erwähnt. Wir sind hier auf dem Dorf mit der Natur verbunden. Wir genießen die Nähe zu Wiesen und Feldern. Hier können Menschen wunderbar spazieren gehen, Rad fahren oder sich bei sonstigen Freizeitaktivitäten in der Natur entspannen.
Von ganzem Herzen kann ich sagen: Ja, ich lebe. Ich lebe in Freiheit und Sicherheit. An den meisten Tagen meines Lebens bin ich frei von Angst. Natürlich mache ich mir wie viele andere Mitmenschen meiner Zeit Gedanken über die unterschiedlichen Krisen dieser Zeit. Und trotzdem stehe ich an den meisten Tagen gut gelaunt und hoffnungsvoll auf und gehe meiner Arbeit nach. Hier auf dem Dorf ist das Leben noch recht beschaulich und unerschüttert. Ich könnte allerdings auch von Menschen berichten, die zurzeit ein anderes Lebensgefühl haben. Und ich kann auch sagen: Wir sind etwas beunruhigt, wie sich unser Leben in Zukunft entwickelt. Werden unsere Kinder und Enkelkinder auch noch frei und sicher leben können?
Der politische Wind ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schärfer geworden. Darüber schrieb ich Ihnen bereits. In den Nachrichten und auf den sozialen Medien werden wir förmlich überflutet mit der Szenerie des Krieges und den unerträglichen Folgen für die Menschen, vor allem für die Kinder.
Ich bin bald 63 Jahre alt und kann rückblickend auf mein Leben sagen, dass ich immer in Freiheit und Sicherheit gelebt habe. Das konnten Generationen vor mir in dieser Weise nicht von sich behaupten.
Von einem Tag möchte ich ihnen erzählen, an dem mein Leben allerdings massiv ins Wanken geriet. Es war der 11.September 2001. Ich stand vor dem Fernseher und die Bilder, die ich sah, ließen mich erstarren. Die Terrorgruppe Al-Qaida hatte an diesem Tag Amerikas Verletzlichkeit offenbart. Vier Flugzeuge waren mitsamt aller Passagiere entführt und zum Absturz gezwungen worden. Ich sehe noch diese zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York City stürzen. Ich sehe Menschen, die fliehen vor der Rauchwolke der zusammenstürzenden Gebäude. Die Fassungslosigkeit und Angst um Leib und Seele in ihren aufgerissenen Augen. Ein weiteres Flugzeug wurde in das Pentagon in Washington gesteuert und eine vierte Maschine stürzte in Shanksville in Pennsylvania ab. Über 3000 Menschen verloren an diesem Tag ihr Leben. Über 3000 Menschen durch einen Terroranschlag ermordet. Es war ein Schock. Es war schrecklich. Es war traurig.
Und nicht nur Amerika trauerte, sondern wir alle mit ihnen. An diesem Tag fanden an vielen Orten Gottesdienste statt. So auch in unserer Kirche. Wir suchten hilflos nach Worten. Wir bargen uns in biblischen Zusagen. Wir beteten um Kraft und Trost für die Angehörigen der Opfer und auch für uns. Wir brauchten Geborgenheit nach einem Tag, der uns vor Augen geführt hatte, wie schnell sich Dinge ändern können. Geborgenheit bei Gott und in der Gemeinschaft von Menschen.
Während ich Ihnen das schreibe, sehe ich diesen Tag noch einmal sehr klar vor mir. Meinem Mann, der sich gerade bei der Kartoffelernte befand, versuchte ich in einem ersten Telefonanruf zu berichten, was in New York geschehen war. Ich fand kaum Worte. Ich war wie erstarrt. Und nicht nur ich, sondern die ganze Welt sah zum größten Teil mit Erschrecken zu, wie Amerika vor den Folgen des Terrorismus traumatisiert in einen Schockzustand geriet.
Sie, verehrte Mrs. President haben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt. Diese erste Hälfte war vor allem schrecklich und unerträglich. Vermissung der Menschlichkeit. Chaos, Zerstörung, Umwälzung. Jahrelang. Hilfloses zuschauen und kein Ende in Sicht. Was die Welt gerade in den Weltkriegsjahren nicht sehen konnte, waren Sicherheit, Leben und Freiheit.
Danke, dass Sie und ihre Kommission aus all dem Erlebten diesen dritten Artikel der Menschenrechtserklärung verfasst haben. Ich hätte eine Idee: Wir sollten ihn mutig und widerständig überall an großen Plakatwänden für alle gut leserlich anbringen. Wir sollten ihn wie Kleidung an Wäscheleinen hängen. Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Eine Vision teilen. Und wer es liest, sollte ihn auf Postkarten schreiben und an Menschen verschicken, die gerade eine Ermutigung brauchen.
Damit wir nicht verlieren, was unser Leben reich macht: Das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Ich danke Ihnen. Sie machen mir Mut.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Ihre C. Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.
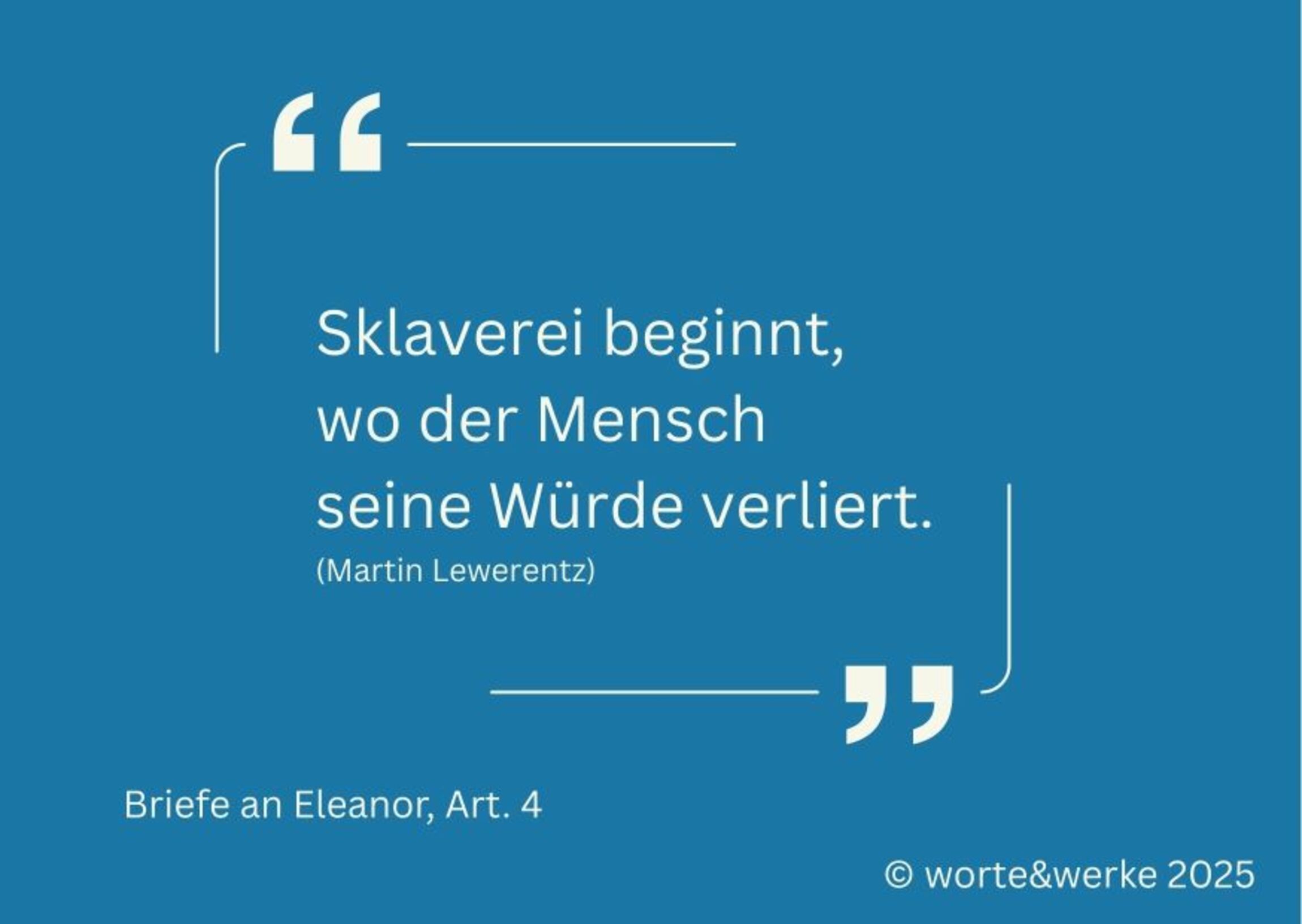
Sittensen, den 30.06.2025
Verehrte Mrs. Roosevelt!
Ich erlaube mir die Anrede etwas zu verändern und bitte um Verzeihung, wenn ich Sie damit etwas überfalle. Sie sind mir beim Schreiben so viel nähergekommen, dass mir dieses „Verehrte Mrs. President“ nicht mehr so leicht über die Lippen kommt. Nun gut. Es mag sein, dass es Ihnen ähnlich geht und Sie über diese Änderung ganz froh sind.
Das Thema über das ich Ihnen schreiben werde, ist allerdings kein Leichtes. Sie ahnen es: Art. 4 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es geht um Sklaverei. Um das Verbot. Um die Abschaffung der Sklaverei, so wie es in Ihrem Heimatland USA im Jahr 1865 endlich in die Verfassung aufgenommen wurde. Europa war in diesem Punkt etwas früher entschlusskräftig. Aber darum geht es nicht.
Die Abschaffung von Sklaverei war und ist schwer durchsetzbar. Große und komplexe Vorgänge und Veränderungen mussten durch kleine richtungsweisende Schritte über einen längeren Zeitraum bedacht und realisiert werden. Trotzdem sollte man meinen, dass 160 Jahre später die Sklaverei in unserer Welt gänzlich verschwunden sein müsste. So ist es aber nicht.
In unserem Jahrhundert gibt es den Begriff der „modernen Sklaverei“. Eine für mich gruselige Kombination von zwei Worten, die nichts – aber auch gar nichts miteinander zu tun haben sollten. Dahinter verbergen sich unterschiedlichste Formen von Gewaltanwendung und Unterdrückung, Missbrauch und Ausbeutung, die alle dem einen Zweck unterliegen: Die Anreicherung von Kapital und Profit bei einzelnen Menschen oder Unternehmen. Ich könnte Ihnen jetzt lang und ausführlich erzählen über Zwangsprostitution, Zwangsheirat, Zwangsarbeit, Menschenhandel und Knechtschaft aufgrund von Verschuldung, die auch heute noch erlitten wird, weil rücksichtslose Menschen Schwächere missbrauchen. Erschütternd in diesem Zusammenhang ist, dass vor allem das Leben von Frauen und Kindern nachhaltig zerstört wird. Ihnen würden beim Erzählen dieser Lebensgeschichten die Tränen in die Augen steigen. Mir ging es auch so.
Es macht mich aber nicht nur traurig, sondern auch wütend, dass es scheinbar diese „Schlupflöcher“ gibt, die es korrupten Firmen und Menschen ermöglichen, andere, schwächere und schutzlose Menschen zu versklaven.
„Sklaverei beginnt, wo der Mensch seine Würde verliert. Wo Kapital geschlagen wird aus seiner Arbeit, aus seiner Person, aus seinem Körper.“ (Martin Lewerentz von der Menschenrechtsorganisation IJM Deutschland e. V.)
Kinder, die auf Müllhalden arbeiten, auf denen Elektroschrott verbrannt wird, um dadurch an Gold, Kobalt, Kupfer oder andere Rohstoffe zu kommen. Ich möchte aufspringen und rufen: „Hört auf damit! Seht ihr nicht, was ihr tut?“ Für unsere Sicht von Wohlstand wird das Leben von ca. 18 Millionen Kindern gefährdet. Nun kommen mir erneut die Tränen.
Ich werde diesen Brief beenden, indem ich Ihnen von meiner Sehnsucht schreibe:
Ich sehne mich danach, dass Kinder einfach nur Kinder sein dürfen. Überall auf der Welt. Spielen, lachen. Kinder, die eine Welt entdecken, die ihrer Neugierde so entgegenkommt und die dann zu Erwachsenen werden, die mit einem guten Rückgrat durchs Leben gehen.
Sie werden mich nicht wegen dieser Sehnsucht verlachen, verehrte Mrs. Roosevelt. Da bin ich mir sicher. Und das schätze ich an ihnen. Danke, dass ich Ihnen so offen davon schreiben darf.
Ich grüße Sie herzlich
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
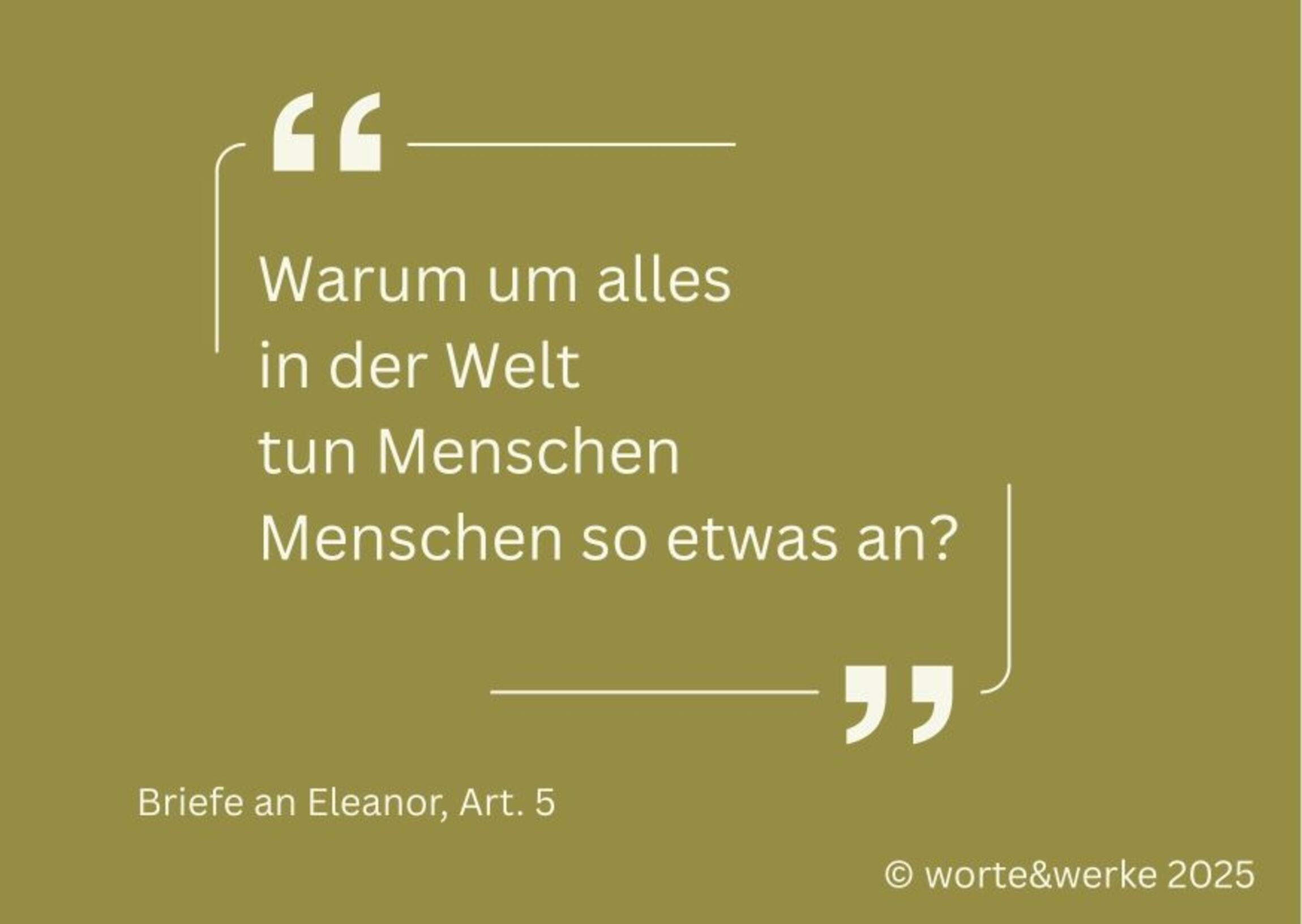
Sittensen, den 01.07.2025
Verehrte Mrs. President,
etwas Unerwartetes ist geschehen. Als ich begann, diese Briefe an Sie zu schreiben, hatte ich nicht damit gerechnet, dass mich die Thematik zu den unterschiedlichen Artikeln der Menschenrechte persönlich so mitnehmen würde. Es geht mir richtig unter die Haut, wenn ich näher in die Erklärung einsteige und mich damit auseinandersetze. Und so war es auch an diesem Mittwochmorgen im Juli, an dem ich Ihnen heute schreibe.
Sie schreiben im Artikel 5:
„Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen sein.“
Sie wussten aus der Vergangenheit von Foltermethoden. Sie hatten genug Geschichten gehört oder gelesen. Ich erinnere mich an Berichte aus Deutschland 1933-45. Unerträglich, jede Zeile, die ich las. Folter ist ja nicht nur Misshandlung. Es ist mehr. „Menschen geben ihre Mitmenschlichkeit auf.“ Sie nehmen sich im Namen des Staates die Freiheit heraus, andere unter Anwendung von Folter zu Geständnissen – seien sie nun wahr oder unwahr – zu zwingen. Menschen werden zu Objekten degradiert, mit denen andere tun und machen können, was in ihrer Macht steht.
Ich werde hier keine Liste der unterschiedlichsten Foltermethoden erstellen. Aber ich erzähle Ihnen von einem Vortrag, den ich neulich besucht habe. Ein junger Mann, ca. 30 Jahre alt, berichtete von seiner Arbeit auf einem zivilen Seenotrettungsschiff im Mittelmeer. Er erklärte uns die Fluchtwege. Besonders die Fluchtwege über Libyen nach Europa. Er zeigte auf einer Karte, was Flüchtlingen geschieht, die den Weg durch die südliche Sahara nach Libyen wählen. Wer diese Fluchtroute überlebt, und nicht schon in der Wüste stirbt, geht nicht direkt auf ein Flüchtlingsboot und fährt Richtung Europa. Nein, die grausame Realität ist diese: Die Menschen werden in einem Internierungslager „aufgenommen“. In diesem Internierungslager geschehen schlimme Dinge, die von den Bewachern gefilmt werden, um so von den Familien der Opfer Geld für die weitere Reise nach Europa zu erpressen. Ich erspare Ihnen die Details. Es war so schrecklich das alles anzuhören. Warum um alles in der Welt tun Menschen so etwas anderen an?
Ich bin dankbar dafür, dass es in Deutschland mehrere Zentren und Einrichtungen gibt, die sich besonders um Geflüchtete und Migrant*Innen kümmern, die eben solche Erfahrungen auf ihrer Flucht machen mussten. Das Zentrum „Überleben“ in Berlin, um nur ein Beispiel zu nennen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch umfassende professionelle Hilfe geflüchteten Menschen eine Rückführung in ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Dort wird eng mit öffentlichen und regionalen Trägern zusammengearbeitet, damit die Unterstützung den Menschen zukommt, die nach ihrer Flucht traumatisiert in Deutschland angekommen sind. Durch Psychotherapie, Kunsttherapie, psychosoziale Beratung und Sprechstunden können Betroffene von Gewalt unterstützt werden. Ich könnte Ihnen auch vom „Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm“ erzählen oder andere Einrichtungen nennen. Es bewegt mich sehr, dass sich Menschen in diesen Einrichtungen für die psychische Genesung einzelner und deren Menschenwürde einsetzen.
Ein Hoffnungsschimmer denke ich gerade. Licht ins Dunkel bringen. Gut, dass Menschen dieses Problem heute ernst nehmen und es von offizieller Seite dafür auch entsprechende Unterstützung und Gelder gibt.
Eine der guten Geschichten, die ich Ihnen aus meiner Zeit heute erzählen kann. Es sollte noch viel mehr davon geben, damit die Geflüchteten trotz des Erlebten weiterleben können. Damit sie ein Zuhause finden in einem Land, das ihnen fremd ist und in dem sie nicht von allen erwünscht sind.
Lassen Sie uns Kerzen anzünden, verehrte Mrs. Roosevelt, damit sich das Licht der Hoffnung gegen die Dunkelheit durchsetzt. Für die Menschen, die Schlimmes erleben mussten.
Und lassen Sie uns aufmerksam die Zeitung lesen und schauen was in anderen Ländern geschieht. Lassen Sie uns beten für die Millionen Menschen, die in Gefängnissen sitzen und der Folter nicht entkommen. Und dass wir nichts überlesen, nur weil in Deutschland Folter gerade keine angewandte Praxis ist.
Mit nachdenklichen Grüßen
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 6
Jeder Mensch hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
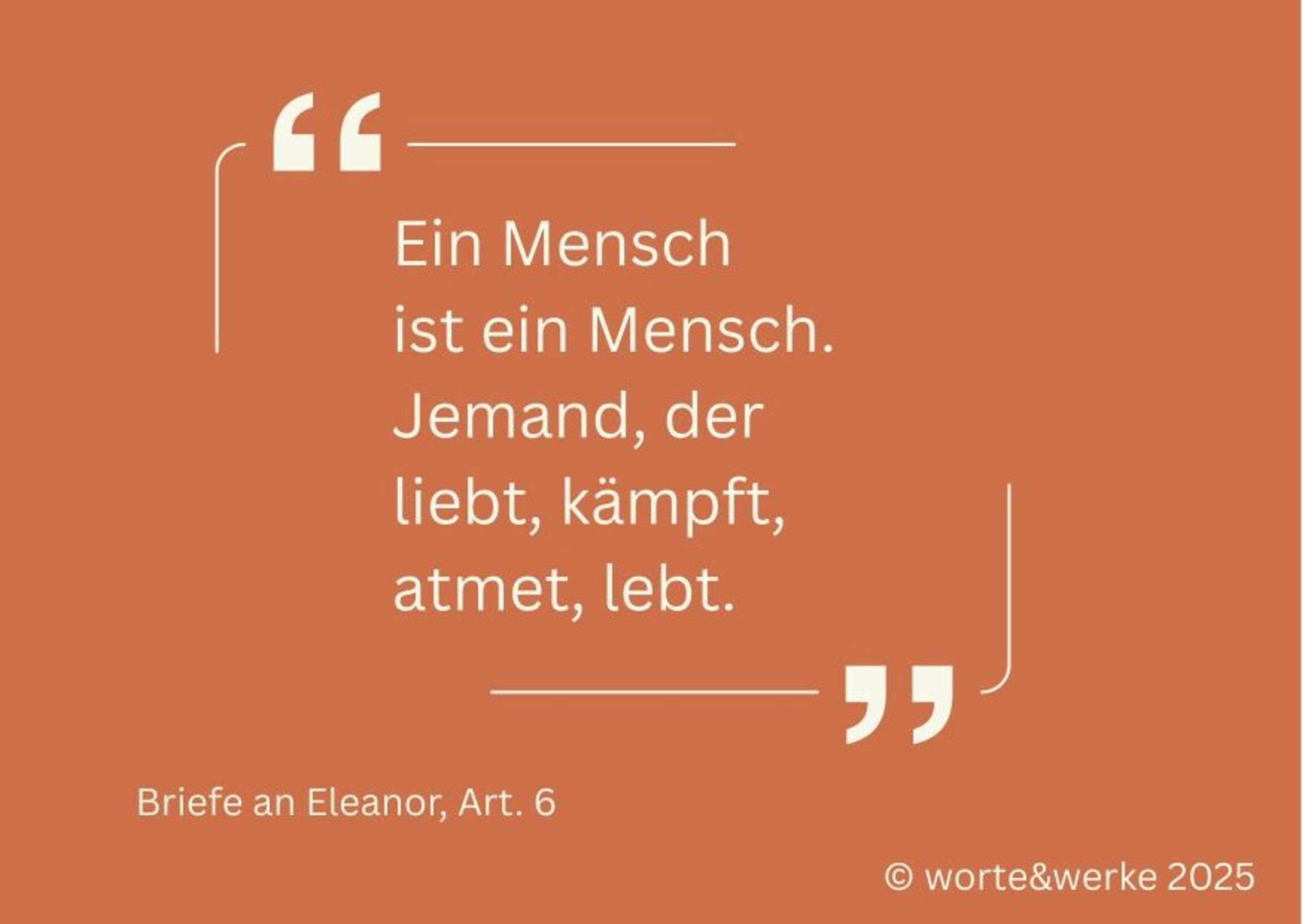
Sittensen, den 03.07.2025
Verehrte Mrs. President!
Ich bewundere Sie. Vieles, was ich über Sie lese, versetzt mich in Staunen. Manchmal schmunzele ich still vor mich hin und dann wieder merke ich, wie ich mich innerlich aufrichte- vor lauter Respekt. Ihre Charakterstärke, von der ich lese, dass Sie sich im Laufe Ihres Lebens immer mehr den Idealen von Gerechtigkeit und Menschenrechten verpflichtet gefühlt haben. Sie sind so voller Entschlossenheit, Dinge genau anzusehen und zu ändern. Ich hätte auch gerne etwas mehr Chuzpe, also Mut und Selbstbewusstsein. Nur so konnten Sie vermutlich mit Ihren Kommissionsmitgliedern den Art. 6 der Menschenrechtserklärung formulieren: „Jeder Mensch hat das Recht überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.“
Ein Mensch ist ein Mensch. So verstehe ich Sie. Kein Ding, kein Objekt. Jemand der fühlt, spürt, Glück und Unglück verarbeiten muss. Ein Mensch hat Rechte und Pflichten. Auch das zeichnet einen Menschen aus und unterscheidet den Menschen von einem Gegenstand. Ein Ding ist ein Ding. Das kann rumstehen, funktionieren (wäre gut) oder nicht funktionieren (wäre ärgerlich). Wenn es nicht mehr gebraucht wird, wird es ignoriert oder entsorgt.
Ein Mensch ist aber ein Mensch. Eine einzigartige Persönlichkeit. Von Anfang an. Kurz nach der Geburt, wird ein Name gesucht und am Standesamt gemeldet. Die Geburtsurkunde zeichnet einen Menschen aus. Sie sagt etwas über den Geburtsort, das Geschlecht, die Zugehörigkeit. Sie ist der Nachweis für eine eigene Identität und für unsere ureigene Existenz.
Liebe Mrs. Roosevelt, ich hörte mit Betroffenheit einen Bericht, in dem einem Kind, die Ausstellung der Geburtsurkunde verwehrt wurde. Das zuständige Amt, wollte dem Vater seine Identität nicht glauben. Und aus diesem Grund wurde dem Kind keine Urkunde ausgestellt. Einem kleinen neugeborenen Baby … verstehen Sie? Ähnliche Vorfälle gibt es immer wieder. Ist das nicht unfassbar? Erlauben Sie mir die Frage, ob der Mensch an sich gar nichts mehr zählt? Wer nicht gesehen wird, fällt aus dem System.
Ich erzähle ihnen auch von den Rohingyas. Seit 40 Jahren sind sie auf der Flucht. Geflüchtete aus Myanmar. Ihnen fehlt es an allem. Heimat, Papiere, Verdienst, Gesundheitsversorgung. Menschen, die nicht wie Menschen gesehen werden. Nicht anerkannt. Keine Zugänge zu irgendwelchen Rechten.
Ich wünschte mir, liebe Mrs. Roosevelt, Sie gäben mir etwas ab von Ihrer Chuzpe. Mut und Entschlossenheit würden ich und andere gebrauchen, um Missstände laut zur Sprache zu bringen. Um es in dieser Zeit immer wieder zu sagen: Ein Mensch ist ein Mensch. Kein Ding, kein Objekt. Ein Mensch ist ein Mensch: Jemand der/ die liebt, kämpft, atmet, lebt.
Danke, dass Sie nicht aufgehört haben, für die Rechte aller Menschen aufzustehen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
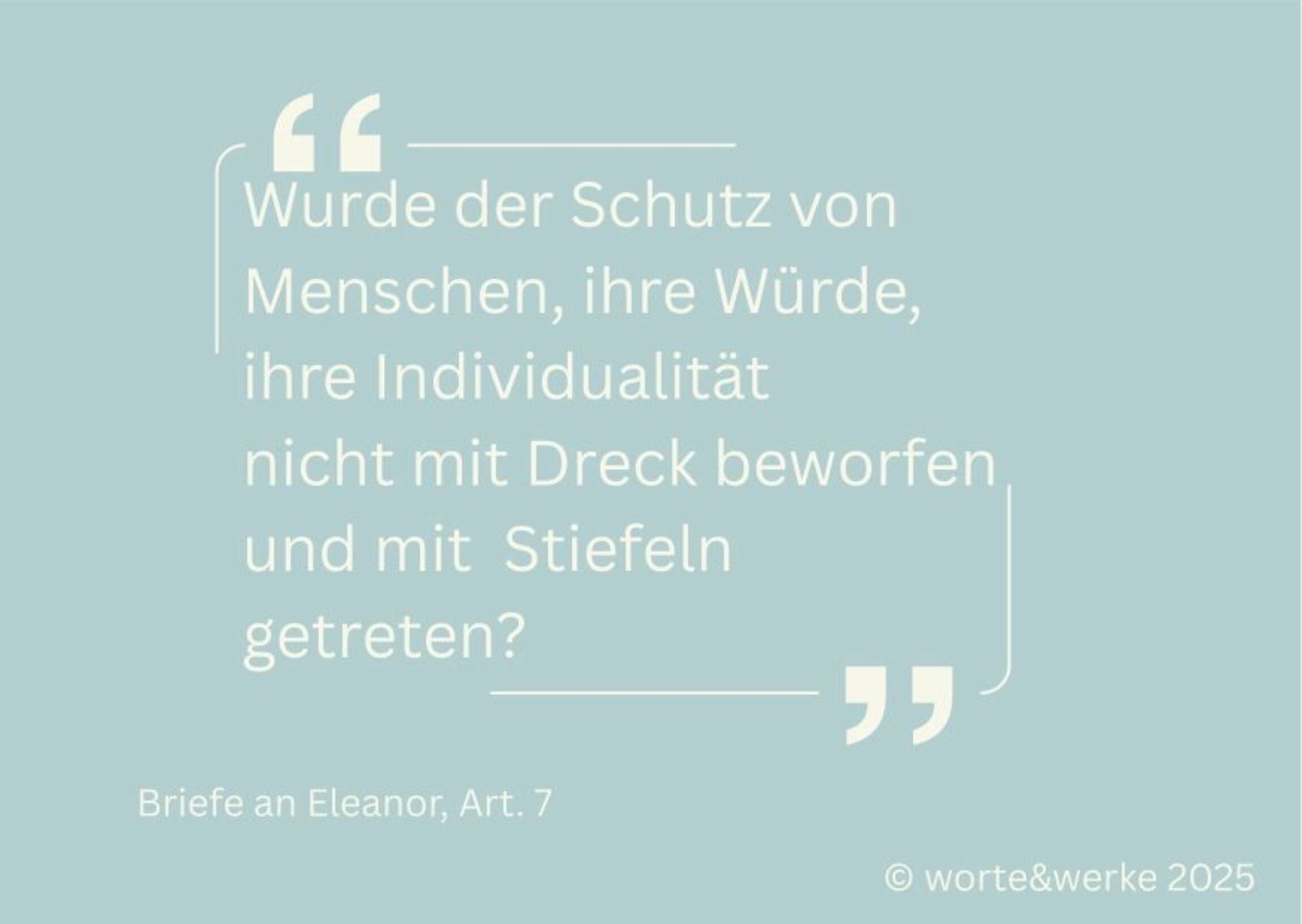
Sittensen, den 13.07.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
während ich mir den Art. 7 der Menschenrechtserklärung durchlese, überkommt mich eine Gänsehaut. Ich möchte Ihnen das in den folgenden Zeilen erklären.
Sie sprechen große Worte aus: „Gleichheit vor dem Gesetz“, „ohne Unterschied“, „gleicher Schutz“. Ich denke, Sie und Ihre Kommission wissen, warum sie diesen Artikel mit diesen Worten gewählt haben. Hatte nicht der zweite Weltkrieg und gerade das nationalsozialistische System alle Gedanken von Gleichheit vor dem Gesetz verworfen? Wurde der Schutz von Menschen, ihre Würde, ihre Individualität nicht mit Dreck beworfen und mit Füßen, die in Stiefeln steckten, getreten? Und sah die Welt nicht den Rauch aus den Schornsteinen der Konzentrationslager austreten? Erzählte dieser Rauch nicht die traurige Geschichte von Millionen von Menschen, die eben anders und nicht gleich vor dem Gesetz waren? Der Rauch aus den Schornsteinen war ein Signal dafür, dass die Menschlichkeit verloren hatte. Es gab nur dieses eine Streben einer Herrenrasse nach internationaler Macht. Dieses Streben versetzte die Welt in Schrecken, zerstörte Träume und Hoffnungen, tötete Menschen und machte den Frieden in der Welt jahrelang unmöglich.
Ich bin so dankbar für Ihre Worte, die Sie 1948 gefunden haben:
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz.“
Ihre Formulierung strotzt nur so von Widerstandskraft gegen die widerwärtige Denkweise der Nationalsozialisten. Gesetze sollten Schutzräume für jeden und jede sein.
Sie und ich, wir erinnern uns doch beide an die Ungleichheit von Männern und Frauen. Erst 1977 wurde im deutschen Arbeitsrecht die Benachteiligung von Frauen beseitigt. Davor durften Männer ihren Ehefrauen verbieten, einen gewählten Beruf auszuüben. Männer auch ohne Absprache mit ihren Frauen die Arbeitsverträge ihrer Frauen kündigen. Und glauben Sie nicht, das niemand davon Gebrauch gemacht hätte. Für mich heute ein unvorstellbarer Zustand.
Heute können Menschen unterschiedlicher Herkunft vor einem Gericht auftreten. Das Gericht wird nicht fragen: Wie viel Geld hast du? Woher kommst du? Was für ein Geschlecht hast du? Was glaubst du? Wen liebst du? Es wird sagen, wir sind hier und verhandeln einen Streitfall ohne Ansehen der Person, ohne jegliche Art von Diskriminierung. Hier bekommt jeder und jede den Schutz, der ihm oder ihr laut Gesetz zusteht.
Würden – um mal ein ganz profanes Beispiel zu nennen – zwei Brüder auftreten, von denen einer reich und ein anderer arm ist, die um das Erbe des Vaters streiten. Dann würde das Gericht nicht sagen können: „Weil du reich bist, kannst du wohl besser mit Geld umgehen und deshalb gehört dir auch das Erbe des Vaters. Und weil du arm bist, wirst du mit dem Erbe nicht umgehen können, deshalb hast du es auch nicht verdient.“
Das Gericht wird auch nicht sagen: „Du bist reich, du brauchst nichts mehr und du bist arm, du kannst das Erbe bekommen.“
Das Gericht wird schauen, wie in diesem Fall nach dem Gesetz verfahren werden soll. Es wird nicht diskriminieren. Es fühlt sich dem Schutz und dem Anspruch auf Gleichbehandlung verpflichtet.
Sie, liebe Mrs. Roosevelt, hatten immer im Blick, dass Gesetze für das Recht stehen müssen und nicht das Unrecht befeuern dürfen. Gesetze sollten einen Schutzraum bieten, anstatt Menschen weiteren Bedrohungen und Ängsten auszusetzen. Ich würde es so sagen: Sie verehrte Mrs. Roosevelt haben aus der Vergangenheit gelernt. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht.
Leider nehmen wir heute wahr, dass es nicht gelingt und nicht überall Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Gerade in totalitären Systemen werden Menschen verschleppt, gefangen genommen, in Scheinverhandlungen verurteilt, in Arbeitslager weggesperrt und getötet. Eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Leider auch auf unserem Kontinent.
Darf ich Ihnen, liebe Mrs. Roosevelt sagen, dass ich gegenwärtig mit wachsender Sorge beobachte, wie auch in Deutschland der Rechtspopulismus lauter wird und sich mit rechtsextremen Positionen politische Erfolge feiern lassen.“
Trotzdem möchte ich dafür eintreten, dass unsere Welt nicht nur gefährlich, sondern auch verheißungsvoll ist. In meiner näheren Umgebung werden in diesen Sommermonaten einige Kinder geboren. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, eines von ihnen auf den Arm nehmen zu können, wenn es noch ganz klein ist. Jemand hat mal gesagt: „Jeder neue Mensch ist ein Zeichen dafür, dass Gott die Freude an dieser Welt noch nicht verloren hat.“
Darauf hoffe ich. Davon möchte ich mich anstecken lassen.
Und dann nicht länger schweigen, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Vielleicht eine gute Übung, im eigenen Umfeld damit zu beginnen.
Ich grüße Sie von meinem Schreibtisch.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 8
Jeder Mensch hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
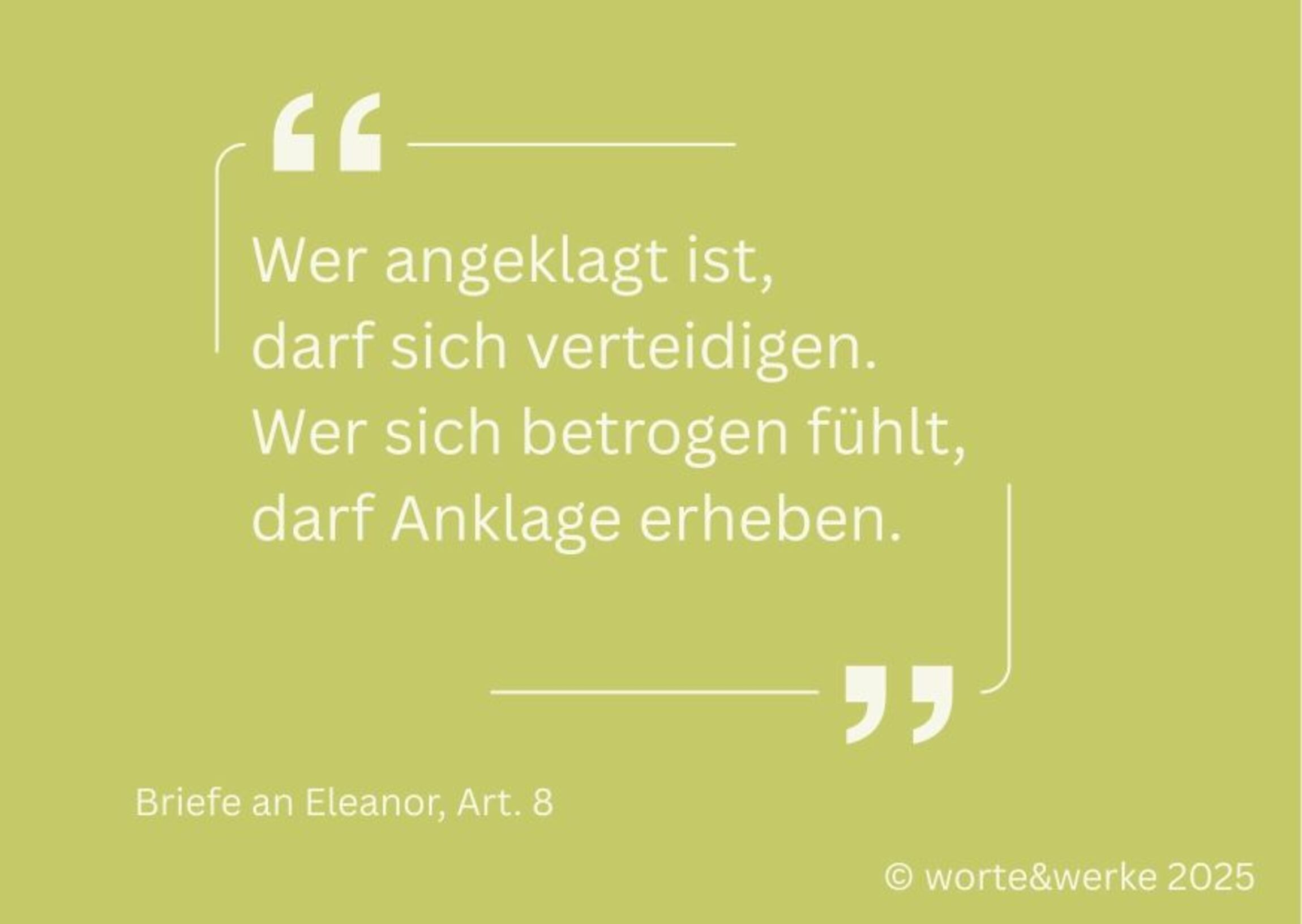
Sittensen, den 15.07.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
gerade ist etwas Unglaubliches geschehen. Ich möchte es gerne mit Ihnen teilen. Ich ahne, dass Sie so etwas kennen.
Ein Gedanke hat mich beim Schreiben und Lesen mit solcher Intensität erfasst, dass ich merkte, wie eine Spur von Glück durch meine Blutgefäße zog. Ich wurde plötzlich ganz still, ganz konzentriert und sehr dankbar. Ich hatte den Eindruck mit mir selbst im Reinen zu sein.
„Jeder Mensch hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gericht zustehenden Grundrechte verletzt werden.“ Art. 8
Vielleicht fühlt es sich so an: Eine Vision zu bekommen, von dem, was möglich wäre, wenn dieses 8. Menschenrecht umgesetzt würde. Ein jeder Mensch soll gehört werden. Egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, mit oder ohne Migrationshintergrund, Arbeit suchend, sich in einem Arbeitsverhältnis befindend oder arbeitslos, Rentner /Rentnerin, gesund oder krank, reich oder arm, Jude, Christ, Moslem oder Buddhist. Egal, was ein Mensch glaubt: Die Zeiten der verschlossenen Türen sollen vorbei sein. Die Schubladen, in die Menschen sich gegenseitig aufgrund von Vorurteilen gesteckt haben, dürfen sich öffnen. Jeder und jede soll gehört werden.
„Ein Stück vom Himmel“, denke ich. Himmel auf Erden ereignet sich, wo genau das schon heute gelingt. Wer angeklagt ist, darf sich verteidigen. Wer sich betrogen fühlt, darf Anklage erheben. Schüler*innen dürfen sich vor der Schulleitung beschweren. Es gibt Schülervertretungen, die sich einsetzen. Arbeiter*innen dürfen sich beim Betriebsrat beschweren. Gewerkschaften setzen sich für die Rechte ihre Arbeitnehmer*innen ein.
Frauen werden gehört. Männer werden gehört. Queere Menschen werden gehört. Geflüchtete werden gehört. Oh, und während ich Ihnen diese letzten Worte schreibe, gerate ich doch ins Stocken, ob das wirklich so ist.
Ja, es ist dieser Traum, diese gute Aussicht, dass wir alle Gehör finden. Und das ohne Ansehen der Person. Überall und in besonderer Weise vor den Gerichten. Immer dann, wenn die Grundrechte von einem oder einer von uns verletzt wurden.
Immer dann, wenn Menschenrechte verletzt werden, werden Menschen verletzt. Der Schweizer Theologe Walter Ludin betont, dass es in Wirklichkeit Menschen sind, die verletzt werden, wenn Menschenrechte nicht beachtet werden.
Es geht immer um den Menschen, um die Würde eines Menschen.
Ich sehne mich mit Ihnen danach, liebe Mrs. Roosevelt, Gutes in diese Welt zu bringen und zu bewirken. Und ich hoffe, dass ich irgendwann erleben kann, dass das Recht sich durchsetzt gegen die Ungerechtigkeit. So wie eine Freundin es oft sagt: „Amen, es werde wahr mit uns.“
In Dankbarkeit,
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
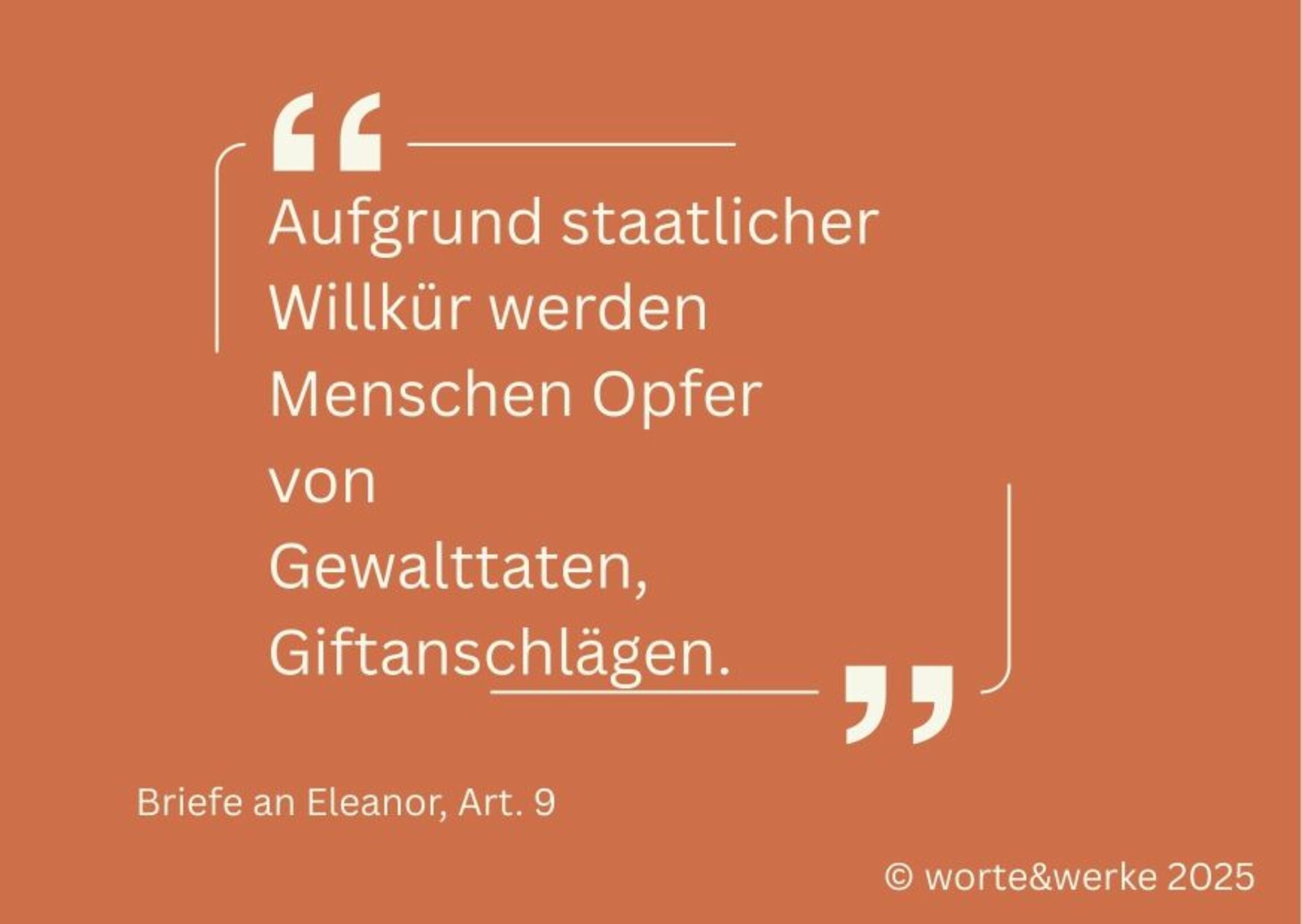
Sittensen, den 28.07.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
Freunde haben mich gefragt, was das denn nun sei, diese „staatliche Willkür“. Ob es sie nicht nur in totalitären Staaten gibt? Ich zuckte mit den Schultern und war um eine Antwort verlegen.
Dann musste ich allerdings an eine Frau denken, von der ich kurz zuvor gelesen hatte: Ihr Name ist Shiva Nazar Ahari. Sie wurde 1984 im Iran geboren und wuchs dort auf. Sie arbeitete als Journalistin, Autorin, Bloggerin und trat für die Menschenrechte ein. Ich nehme Sie, Mrs. Roosevelt, mit in das Jahr 2009. Shiva Nazar Ahari ist auf dem Weg zur Beerdigung eines oppositionellen Führers. Ihr Auto wird angehalten. Sie wird rausgezerrt und festgenommen. Sie wird vor ein „Gericht“ gestellt. Auf der Anklageschrift stehen Punkte wie „Störung der öffentlichen Ordnung“, „Einsatz für Propaganda“. Sie soll „Verschwörungen gegen den Staat“ angezettelt haben. Shiva Nazar Ahari ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Eine junge Frau mit Träumen und Hoffnungen und, Sie werden es ahnen, klaren Vorstellungen, wie es gerechter in ihrem Land zugehen könnte. Sie bestreitet alle diese Vorwürfe, wird aber trotzdem inhaftiert. Im darauf- folgenden Jahr 2010 kann sie gegen eine Kaution von 395.000 € das Gefängnis verlassen.
Liebe Mrs. Roosevelt, denken Sie nur nicht, dass damit die Unrechtsgeschichte an Shiva Nazar Ahari beendet wäre. So schnell wird sie damals kein Leben in Freiheit genießen können. Wenn die Erinnerungen an alle schlimmen Erlebnisse ihr das überhaupt irgendwann einmal zugestehen. Die Journalistin wird erneut festgenommen. Diesmal erwarten sie 76 Peitschenhiebe. (Ja, Sie haben richtig verstanden: Peitschenhiebe…) Dazu sechs Jahre Haft. Als Begründung werden „Staatsfeindliche Aktivitäten“ angeführt. Shiva Nazar Ahari würde diesen Aktivitäten nachgehen und sie fördern.
Würde ich nun fragen, ob die Gerichte im Iran willkürlich handeln, dann würden diese sich dagegen mit aller Macht verwehren. In meiner persönlichen Lesart der Geschichte klingt der Umgang mit Shiva Nazar Ahari aber so: „Wer nicht passt, wird weggesperrt. Als Staatsfeind behandelt.“ Und obendrein ist dieser Umgang mit Menschen noch gesetzlich abgesichert.
Ich kann mir vorstellen, liebe Mrs. Roosevelt, dass Sie dieser Bericht erschüttert. Sie sind Zeugin, dass ein Vertreter des Irans 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen unterschrieben hat. Natürlich waren die politischen Verhältnisse im Iran noch ganz andere. Es gab den Schah als autoritären Monarchen. (Er nannte sich später selbst sogar „König der Könige“). Es gab ein Parlament als Legislative. Durch die islamische Revolution 1979 wurde der Schah gestürzt und floh über viele Staaten nach Ägypten ins Exil, wo er 80-jährig an den Folgen einer Krankheit verstarb. Die islamische Revolution änderte vieles im Iran.
Wenn ich Ihnen das schreibe, bin ich trotz aller Fragen, die ich derzeit auch an unser Land habe, froh, in Deutschland zu leben. Unsere Regierung ist in ihren Entscheidungen an das Gesetz gebunden. Es gibt Grundrechte, die jedem Bürger zustehen. Die Bürger und Bürgerinnen wissen auch, welches Fehlverhalten, vermutlich eine Strafe zur Folge haben könnte. Jeder und jede hat die Möglichkeit, seine Rechte vor einem Gericht geltend zu machen.
Wir sind uns sicher einig, Mrs. Roosevelt, dass Straftaten verfolgt werden müssen und Gerichtsverhandlungen einfach fair sein und bleiben sollen. Aber aufgrund staatlicher Willkür wurden in totalitären Staaten Menschen Opfer von Gewalttaten, Giftanschlägen. Sie wurden und werden interniert, verurteilt und verschwinden auf unerfindliche Arten und Weisen. Ich berichtete Ihnen bereits davon. Ich denke gerade an Alexej Nawalny in Russland und Amal Fathy in Ägypten.
Durch staatliche Willkür wird an einem Menschen exemplarisch demonstriert, was allen Menschen droht, die sich für Gerechtigkeit und Menschenrechte, einsetzen: Einschüchterung, Haftstrafen, Folter bis hin zum Tod.
Bewahre uns Gott vor solchen Regierungen.
Ich grüße Sie für heute, Mrs. Roosevelt.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 10
Jeder Mensch hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.
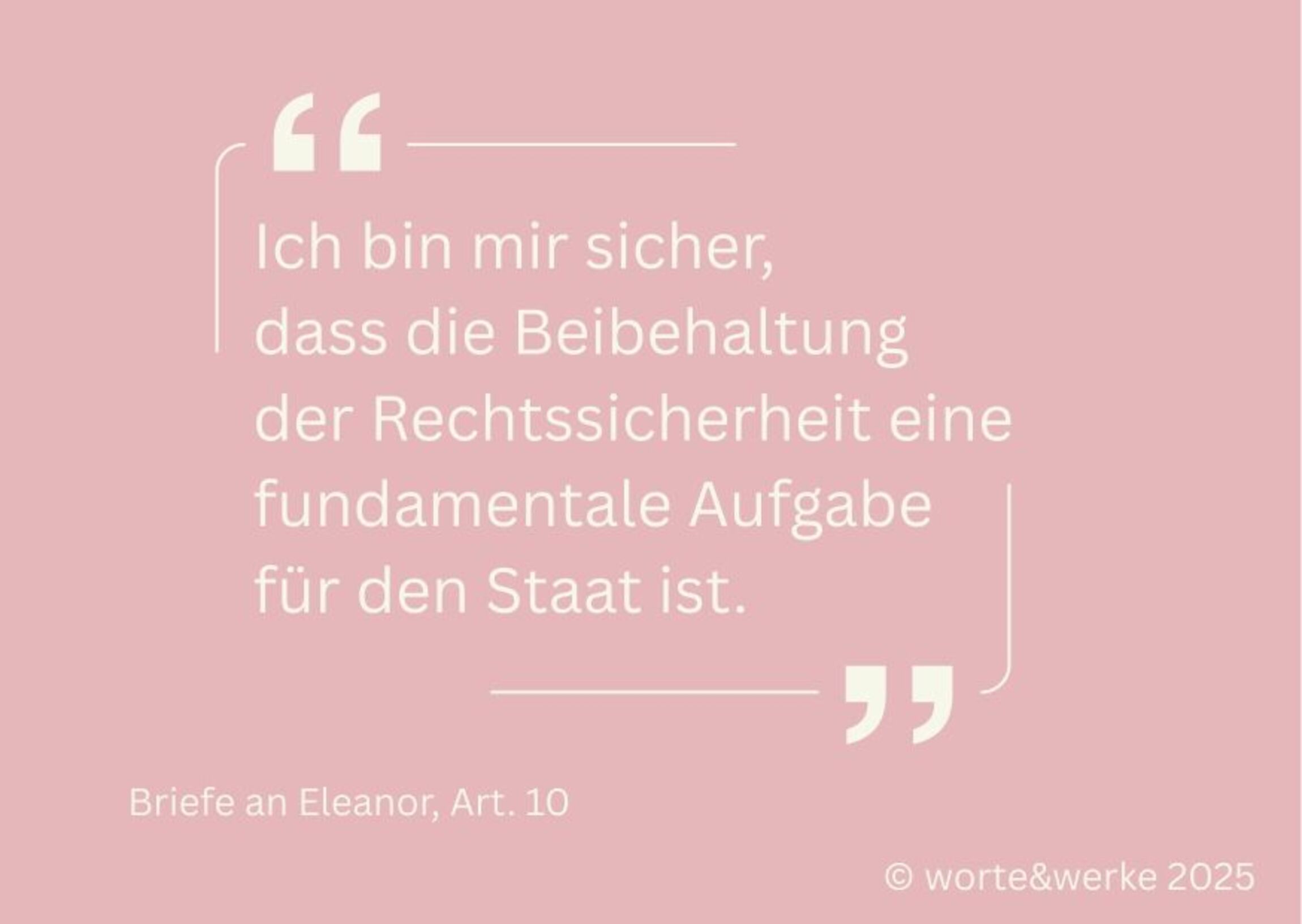
Sittensen, den 01.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
meine Familie hat im vergangenen Jahr ein Haus gebaut. Es ist sehr schön geworden. Am besten gefallen mir die großen Fensterflächen und der Blick in den Garten. Ich denke, in ein paar Jahren werde ich dort einziehen und einen schönen Alterswohnsitz haben. Ich selbst bin handwerklich nicht sehr begabt. Ich hätte mir dieses Haus weder ausdenken, noch mit Handwerkern planen können. Da musste ich mich auf andere Menschen in meiner Familie verlassen. Und trotzdem konnte ich entscheidende Etappen des Hausbaus mitentscheiden und verfolgen.
Ziel eines jeden Hausbaus sollte sein, dass das Haus stabil steht und unangefochten trotz Wetterkapriolen durch die nächsten Jahrzehnte kommt. Nur so können sich die Hausbewohner in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Nun besteht ein Haus ja nicht nur aus dem, was man sieht: Wände oder Dach oder Fenster, nein, es braucht ein festes Fundament. Ich habe mir sagen lassen, ein Fundament aus Beton ist zwar schon früh begehbar, aber erst nach 28 Tagen voll tragfähig. Und wenn dieser Zustand der vollen Tragfähigkeit erreicht ist, kann darauf gebaut werden, was das Herz, der Geldbeutel oder die Kreditbank ermöglicht.
Sie fragen sich, warum ich Ihnen das alles schreibe? Es liegt daran, dass ohne dieses Fundament ein Haus nicht lange überlebt und keine Sicherheit bietet. Und Sicherheit ist mein Stichwort, liebe Mrs. Roosevelt. Menschen suchen Sicherheit im alltäglichen Leben. Leben fordert uns heraus. So gut es geht, sorgen wir für uns und die Menschen, die wir lieben. Niemand möchte in Schwierigkeiten geraten. Wir kennen die Rechte und Pflichten innerhalb des eigenen Kontextes. Und dann passiert es trotzdem aus Pech, aus Dummheit, aus einer Verkoppelung tragischer Unfälle oder aus Unachtsamkeit: ein unvorhergesehener Unfall, ein Rechtsstreit, ein durch Wetter verursachter Schaden.
Unser Rechtssystem verspricht für diese Situationen Gleichheit und Anspruch auf faire Verhandlung und Behandlung in meist öffentlichen Verfahren vor einem unparteiischen Gericht. Sie wissen aus ihrem eigenen Erleben, dass viele Verfahren eben nicht gleich oder fair waren. Gerichtsverhandlungen gerade gegen Frauen oder „Farbige“ (wir sagen heute lieber „People of Colour“) ließen Gleichheit und Fairness vermissen. Vorurteile befeuerten die Verhandlungen. Dadurch wurden unschuldige Menschen zu Unrecht verurteilt, oder bekamen, das ihnen zustehende Recht nicht zugesprochen. Ich bin mir sicher, dass die Beibehaltung der Rechtssicherheit eine fundamentale Aufgabe für den Staat, seine Einrichtungen und unabhängigen Gerichte ist.
Gesetze dürfen nicht zufällig und unzuverlässig sein. Gerichte – unabhängig von Kläger und Beklagten – sollen faire und gerechte Urteile fällen und sich an dem Prinzip der Gleichbehandlung messen lassen.
Gesetzt den Fall, dass ich eine Streitigkeit mit einem Menschen nicht allein klären kann, darf dieses Problem vor Gericht verhandelt werden. Ich halte es für ein Vorrecht, das ich nutzen darf.
Sie mussten der Ungerechtigkeit zu manchen Zeiten ins Auge sehen, liebe Mrs. Roosevelt. Die ganze Welt konnte Ungerechtigkeit und unfaire Gerichte in den Kriegsjahren erleben. Manche von diesen sind nicht in Vergessenheit geraten. Ich vermute, dass Sie aus der Geschichte sehr viel gelernt haben und aus diesem Grund diesen 10. Artikel in Ihrer Erklärung zu den Menschenrechten aufgenommen haben.
„Jeder Mensch hat bei der Feststellung der eigenen Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.“
Viele Jahre später bedeutet mir dieser Artikel sehr viel und ich bin Ihnen und Ihrer Kommission sehr dankbar dafür.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 11
Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.
Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
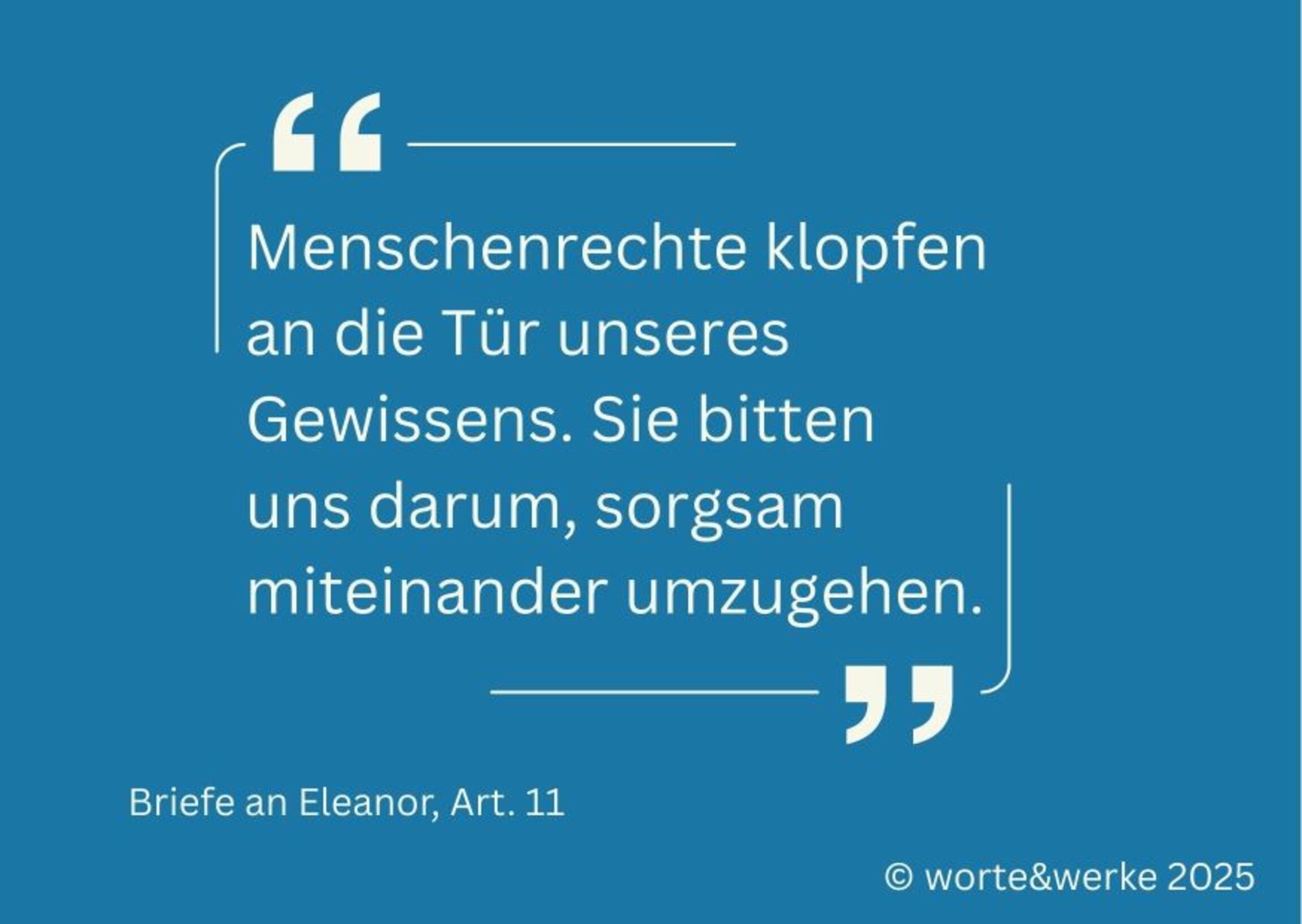
Sittensen, den 04.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
ich gestehe, so sehr ich mir auch vornehme, sorgsam mit meinen Mitmenschen umzugehen … manchmal bin ich kein guter Mensch. Neulich ist es mir wieder aufgefallen. Da bin ich mir selbst auf die Schliche gekommen. Die Sache war so: Jemanden, den ich nicht besonders gut leiden mag, hatte ich in meinem Kopf des Diebstahls bezichtigt. Natürlich gab es für diesen Verdacht Gründe. Ich habe mich nicht getraut nachzufragen. Ich habe diesen Menschen nicht darauf angesprochen. Ich habe es mir selbst einfach so oft eingeredet, dass aus einer Vermutung ein Tatbestand wurde. Allerdings nur in meinem Kopf. Natürlich habe ich auch bei anderen meinen Verdacht geäußert. Ich musste einfach darüber reden, weil es mich so sehr beschäftigte. Lange Rede kurzer Sinn: Am Ende entpuppte sich mein Verdacht als Irrtum. Da stand ich nun. Peinlich berührt. Beschämt über mein viel zu schnelles und falsches Urteil. Betroffen von meiner Unfähigkeit, gut über Menschen zu denken, die ich nicht so gerne mag. Ich hatte jemanden für schuldig erklärt, der sich nichts, aber auch gar nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Mein Eifer, meine Entschlossenheit hatte mich in eine Falle tappen lassen.
Das ist jetzt ein paar Wochen her und ich lese Art. 11 der Menschenrechtserklärung. Ich lese, dass Menschen so lange als unschuldig gelten, bis das Gegenteil erwiesen ist. In allen Belangen des menschlichen Lebens soll das gelten.
Menschenrechte sind ja keine Gesetze. Einige Menschenrechte wurden in unsere rechtsstaatliche Grundordnung aufgenommen. Ich empfinde es so, dass sie an die Tür unseres Gewissens klopfen. Sie bitten uns darum sorgsam miteinander umzugehen. Sie laden uns ein, Menschen zu sein und zu bleiben. Marcel Reif, ein Sportjournalist, hat das bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus 2024 vor dem Deutschen Bundestag in bewegender Weise ausgesprochen. Er berichtete von seinem Vater, der den Holocaust überlebt hatte. Von ihm hatte er den Satz gelernt: „Sei ein Mensch.“
Und genau darum geht es doch bei den Menschenrechten. Sie regen zum Nachdenken an. Sie appellieren an unsere Menschlichkeit. Sie erinnern uns als Einzelne, aber auch die Staaten und Regierungen an Rechte und Pflichten. Sie wecken die Sehnsucht, friedlich und gut miteinander umzugehen. Das Gute zu sehen. In Frieden zu leben. Grenzen nicht zu überschreiten. Den anderen nicht zu verurteilen. Urteile zu sprechen obliegt den Gerichten.
Vor Gericht spielt die Unschuldsvermutung eine große Rolle. Bevor eine Angeklagte/ ein Angeklagter nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt ihre/seine Unschuld.
Die Angeklagten müssen die eigene Unschuld nicht selbst beweisen. Die Staatsanwaltschaft muss die Schuld beweisen. Anschließend fällt das Gericht nach Prüfung die Entscheidung über Schuld oder Unschuld. Dieses Prinzip gilt für jede Verhandlung vor Gericht. Vor dem Amtsgericht wie auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof(IStGH) in Den Haag, der Kriegsverbrechen und Völkermord verhandelt.
Das Menschenrecht der Unschuldsvermutung schützt vor Willkür, liebe Mrs. Roosevelt. Sowohl vor Willkür im täglichen Miteinander als auch vor Willkür bei Gericht.
Nun habe ich etwas gelernt, Mrs. Roosevelt. Ich bin ehrlich: Ich wünsche mir dieses Menschenrecht, würde unsere Herzen erobern, damit wir Menschen ständig eine Chance geben. Damit wir nicht der Gefahr erliegen, unsere Vorurteile in Urteile zu verwandeln. Und das geschieht schneller als uns lieb ist. Da braucht es nur Menschen, die anders aussehen, andere Gewohnheiten haben oder deren Sprache wir nicht verstehen.
Ich nehme mir vor, in Zukunft mehr auf das zu achten, was ich über andere Menschen denke und sage.
Mit freundlichem Gruß
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
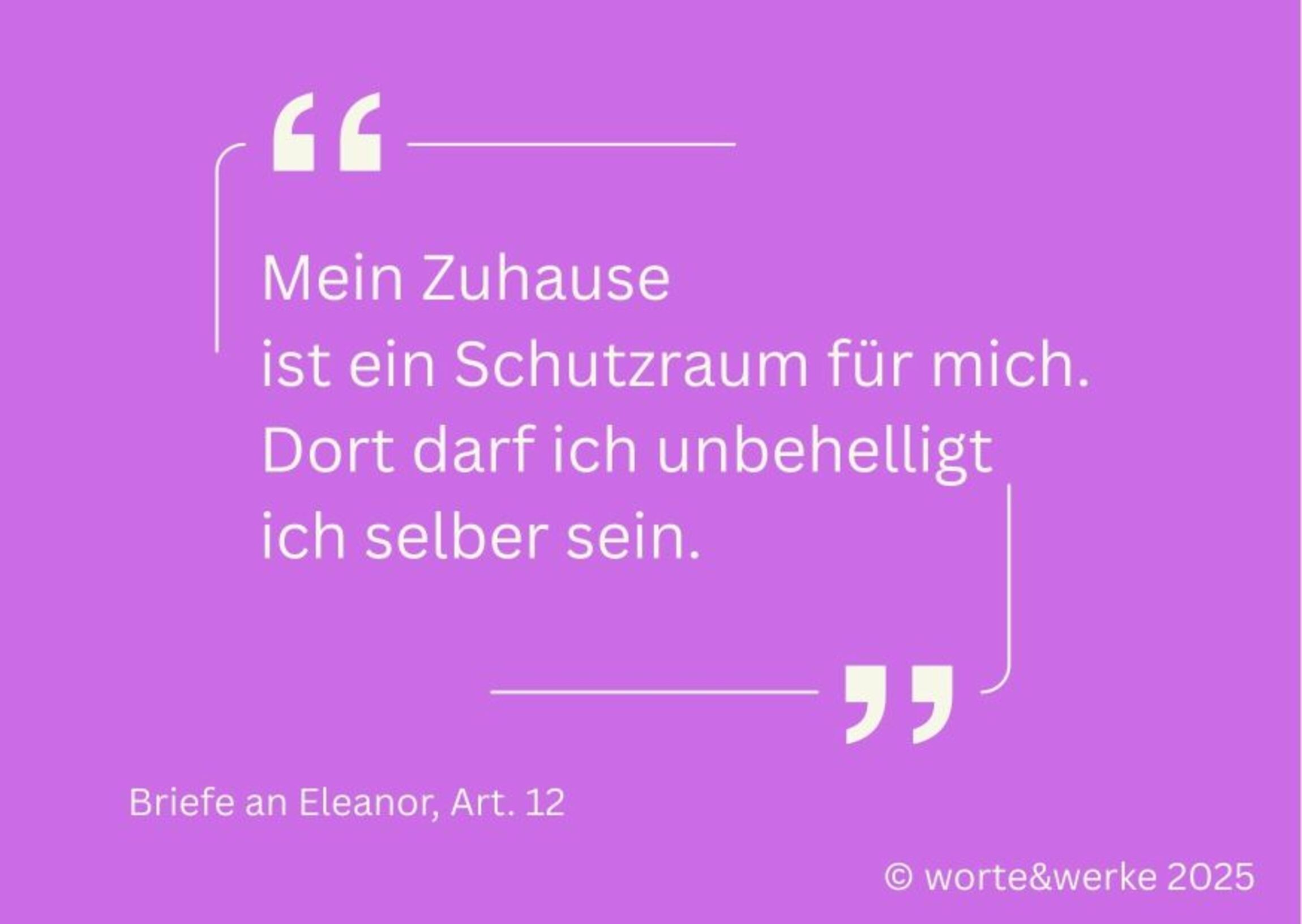
Sittensen, den 05.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
heute Morgen war ich schon sehr früh wach und las im Internet drei Sätze einer deutschen Theologin, die als Professorin in Amerika lebt und unterrichtet. Sie schreibt:
“Protect your joy.
Protect your integrity.
Protect your privacy.“ (Aus: „Such a time as this, Hanna Reichel 2025, S. 79)
„Schütze deine Freude. Schütze deine Integrität. Schütze deine Privatsphäre.“
Diese drei Sätze treffen mich mitten in der Beschäftigung mit Art. 12 der Menschenrechtserklärung: „Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben ausgesetzt sein.“
Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie als Frau des amerikanischen Präsidenten Ihre Privatsphäre wirklich schützen konnten. Wie konnte das gut gehen unter all den vielen Leuten, denen sie täglich im Weißen Haus begegneten? Waren nicht überall dort, wo Sie waren auch Sicherheitsbeamte, Regierungsbeamte, Angestellte oder die Presse? Mittlerweile wird vermutet, dass Sie, liebe Mrs. Roosevelt, eine auch romantische Beziehung zu der Journalistin Lorena Hickok im Weißen Haus pflegten. Sie zeigten sich als Freundinnen, und als Frauen, die gemeinsam arbeiteten. „Hicks“, wie Sie sie nannten, hatte sich als erfolgreiche Journalistin einen Namen gemacht. Sie haben sich gegenseitig in der Arbeit unterstützt. Ich weiß nicht wirklich, welche Art der Beziehung Sie und ‚Hicks‘ nun wirklich geführt haben. Aber es geht mich auch nichts an. Wenn Sie etwas nicht mit mir teilen wollen, muss ich das respektieren.
Und wie geht es uns heute damit? Wie können wir unsere „Privatsphäre“ schützen? Was schützen wir, wenn wir darüber sprechen? Worauf darf niemand willkürlich Zugriff haben?
Was ist denn diese „Privatsphäre“? Darunter fällt die eigene Familie, das Zuhause, das gesamte materielle und geistige Eigentum. „Privatsphäre“ sind Briefe, Mails, Gespräche. Niemand hat das Recht, sich unbegründet oder widerrechtlich Zugang zu all diesen Gegenständen, Menschen und Orten zu verschaffen. Es sei denn, eine*r hat sich durch irgendwas verdächtig gemacht und die Polizei steht mit einer gerichtlichen Anordnung vor der Tür.
So sehr in unserem Land heute über die Feinheiten des Datenschutzes gestöhnt wird, bin ich froh, dass meine persönlichen Daten geschützt werden. Aber auch dieser Schutz wird von verschiedenen Stellen angegriffen und unterlaufen. Dabei handelt es sich allerdings um willkürlich handelnde kriminelle Organisationen, die bewusst schaden wollen. Sichere Passwörter schützen vor Missbrauch. Ein vorsichtiger Umgang mit dem Verbreiten von Fotos und Videos im Internet ist geboten. Es ist an vielen Stellen schon zu niederschmetternden und persönlichkeitsverletzenden Übergriffen gekommen, wo Menschen nicht sorgsam genug mit Bildern von sich selbst und anderen umgegangen sind. Stalking, Mobbing oder die nicht gestattete Weitergabe persönlicher Daten anderer, verletzen die Persönlichkeitsrechte von Einzelnen.
„Schütze deine Privatsphäre. Schütze deine Integrität. Schütze deine Freude.“ Umgedreht zeigt dieser Satz einen Weg zu einem entspannten Lebensstil.
Leider sind manche Zeitgenossen uneinsichtig, bis unbelehrbar darin und posten in den sozialen Medien Dinge, die Ihnen auf Dauer nicht zum Vorteil reichen.
Es gibt, liebe Mrs. Roosevelt, auch heute noch das Briefgeheimnis, obwohl immer weniger Briefe geschrieben werden und auf dem Postweg durch das Land unterwegs sind.
Eine gute Sache, dieser Schutz der Privatsphäre. Denn mein Zuhause ist ein Schutzraum für mich. Dort darf ich unbehelligt ich selber sein. Dort kann ich mich entfalten und auch mal gehen lassen. Ein Ort, der Gefühle schützt.
Liebe Mrs. Roosevelt, vielleicht wissen Sie, wie die Neugier auf die Welt kam. Ich weiß es nicht, aber ich frage mich das an manchen Tagen. Die Neugier hat einen großen Anteil daran, dass Dinge aus der Privatsphäre einzelner Menschen in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Sie ist gierig auf „noch-nie-da-gewesenes“ und überschreitet dabei hemmungslos Grenzen, die besser respektiert werden sollten.
Ich für meinen Teil nehme mir die Sätze der amerikanischen Theologin zu Herzen.
„Protect your joy.
Protect your integrity.
Protect your privacy.“
In diesem Sinne sende ich Ihnen freundliche Grüße.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 13
Jeder Mensch hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
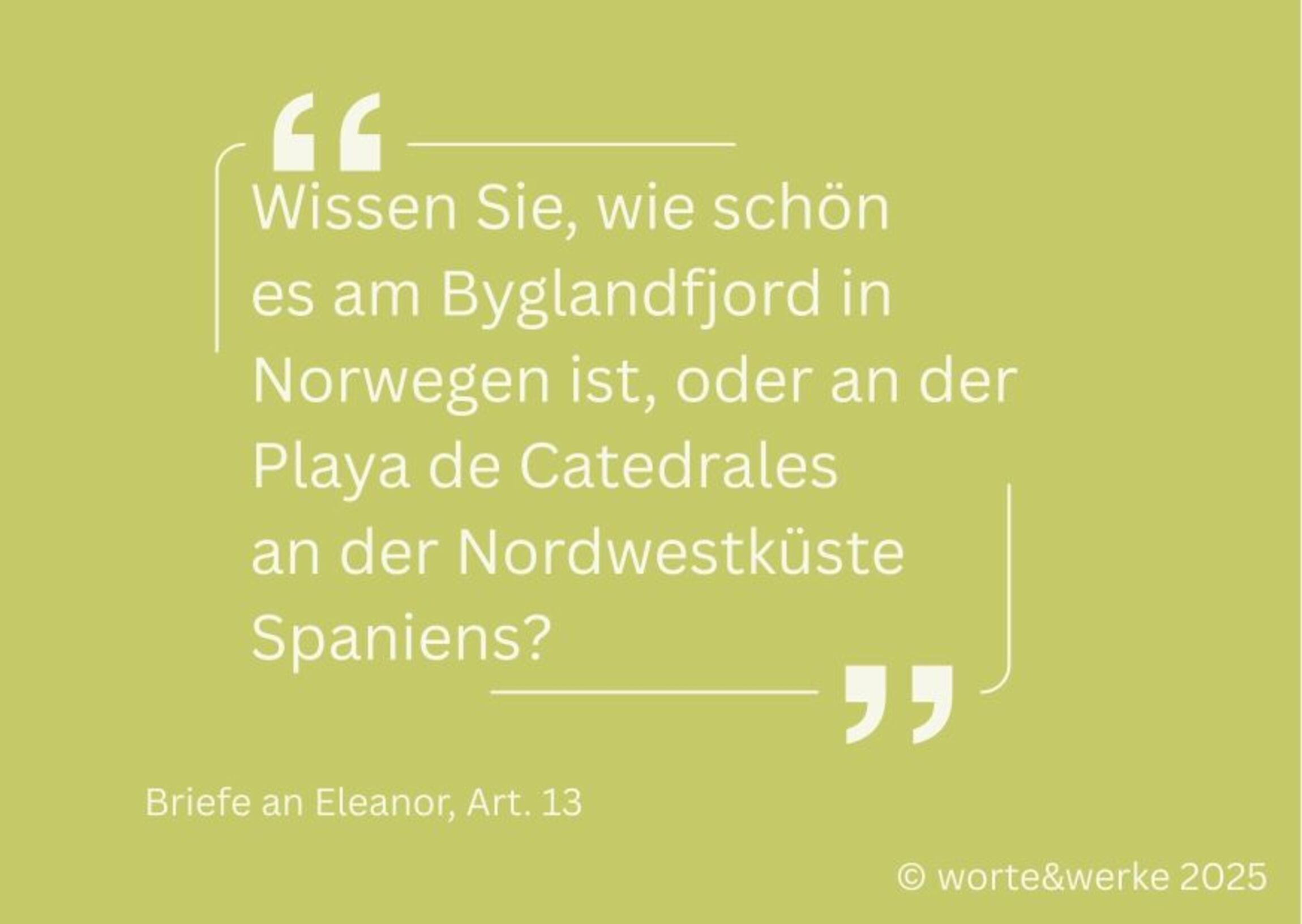
Sittensen, den 09.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
ich vermute, dass Sie eine sehr reiselustige Dame gewesen sind. Jedenfalls berichten mir die Aufzeichnungen und Filme davon, die ich gelesen und angesehen habe, um Sie ein wenig kennen zu lernen.
Für Sie gehörte das Recht auf Reisefreiheit innerhalb Amerikas zu den grundlegenden Voraussetzungen für Ihre vielen Aktivitäten rund um das Voranschreiten der Gleichberechtigung für Frauen, und der Menschenrechte. Sie reisten zu Konferenzen und Demonstrationen. Sie fuhren mit der Bahn zu den Menschen in ihrem Land und interessierten sich für die Situation vor Ort. Sie wussten: Um Menschen zu verstehen müssen sie Ihnen dort begegnen, wo sie leben und Kontakte knüpfen, Beziehungen vertiefen.
Sie kämpften immer wieder, auch für die Rechte der schwarzen Bevölkerung. Spätestens als die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks 1955 festgenommen wurde, nachdem sie sich geweigert hatte, einen Sitzplatz für Weiße im Bus zu räumen, war für Sie liebe Mrs. Roosevelt einmal mehr deutlich, dass das Recht auf Reisefreiheit innerhalb eines Landes nicht für alle Menschen gewahrt war. Zu dieser Zeit gab es in Bussen immer noch Sitzplätze für die weiße Bevölkerung und Sitzplätze für die schwarze Bevölkerung. Heute hat sich vieles auch in Amerika geändert, womit ich nicht sagen möchte, dass alles so in Ordnung ist, wie es läuft.
In den letzten Jahren ist die Technologie weiter fortgeschritten. Die Welt ist mobiler geworden. Fliegen und reisen können ist für viele zur Normalität geworden. Als eine in Deutschland lebende Europäerin kann ich fast überall hinreisen. Innerhalb Deutschlands kann ich mich frei bewegen und reise wohin ich möchte. Ich kann Deutschland verlassen und auch wieder hierhin zurückkehren: per Flugzeug, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Rad oder zu Fuß.
Wissen Sie wie schön es auf dem Byglandsfjord in Norwegen ist, liebe Mrs. Roosevelt, oder an der Playa de Catedrales an der Nordwestküste Spaniens? Wunderbare Landschaften.
Ich kann mit wenigen Ausnahmen in Europa reisen, wohin ich möchte. Gut, nach England bedarf es mittlerweile eins Visums, das rechtzeitig beantragt werden will. Menschen, die in Deutschland nur geduldet sind, ist dieses Auslandsreiserecht untersagt und nur durch ein Antragsverfahren mit individueller Prüfung und in Ausnahmen möglich. Für viele Bürger und Bürgerinnen nicht europäischer Länder bedarf es zur Einreise nach Deutschland eines Visums.
Erinnern Sie sich, Mrs. Roosevelt, dass in Deutschland auch die Reisefreiheit zwischen den beiden deutschen Staaten im August 1961 durch den Bau der Mauer in Berlin und eines innerdeutschen Grenzzaunes sehr eingeschränkt wurde? Jahrzehntelang konnten sich die Bürger*innen dieser beiden Staaten nicht mehr ohne großen behördlichen Aufwand und ohne Angst vor der totalitären Überwachung durch das DDR-Regime begegnen. Sowohl die Einreise in die DDR, als auch die Ausreise für die DDR-Bürger*innen wurde erschwert oder oft sogar verweigert.
Sie haben nicht mehr erlebt, als infolge einer friedlichen Revolution am 09.11.1989 die Mauer fiel. Ich bekomme Herzklopfen, wenn ich an die Bilder und Berichte von diesem Tag denke. Ich kannte nur die Mauer. Und nun war sie plötzlich eingerissen. Menschen lagen sich in den Armen. In den Gewehrläufen der Polizisten steckten Rosen. Seit 1990 ist Deutschland wieder vereint und das Recht auf Reisefreiheit wieder hergestellt. Ja, so war es. Sie hätten dabei sein sollen. Sie hätten sicher mitgefeiert.
Liebe Mrs. Roosevelt, nun beschäftigt mich eine Sache aus den letzten Monaten doch so sehr, dass ich Ihnen dazu etwas schreiben möchte. Seit 1985 gilt zwischen den Europäischen Staaten das so genannte Schengen-Abkommen. Es sollte das unkomplizierte Reisen für die Bürger*innen der unterzeichnenden Staaten garantieren. Im Laufe der Jahre schlossen sich diesem Abkommen neben den fünf Gründungsmitgliedern immer mehr europäische Länder an. Reisen in Europa war unkompliziert. Zeitweise brauchten wir noch nicht einmal unsere Pässe vorzuzeigen.
Und dann kamen 2015 die Flüchtlinge nach Europa. Dazu 2020 die Coronakrise. Die Grenzen wurden aufgrund von Sicherheitsbedenken zeitweise geschlossen und wieder geöffnet.
Seit einigen Monaten verkomplizieren sich erneut die Grenzübertritte zwischen einigen Ländern, die das Schengen-Abkommen unterzeichnet haben. So ist es zum Beispiel zwischen Polen und Deutschland. Neulich hat mir eine Frau aus Polen berichtet, dass sie 15 Stunden an der polnischen Grenze warten musste, um in Deutschland einreisen zu können. Das war vorher alles sehr unkompliziert und mir hat es für diese Frau sehr leidgetan. Es hat mich sehr ins Nachdenken gebracht.
Also frage ich Sie, liebe Mrs. Roosevelt: Was braucht es, um Reisefreiheit zu garantieren? Ist es nicht vor allem das Vertrauen, dass die Menschen, die in unser Land reisen, in der Lage sind sich für eine Zeit, mit unseren Regeln und Gepflogenheiten nicht nur gut zu stellen, sondern diese auch zu unterstützen? Schließen wir nicht aus Unsicherheit oder Angst die Grenzen? Es macht mir Sorge, dass wir Rückschritte machen und diese als Fortschritt bezeichnen.
Zu guter Letzt noch etwas Persönliches, liebe Mrs. Roosevelt: In meinem bisherigen Leben bin ich noch nie über die Grenzen von Europa hinausgekommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so gerne in einem Flugzeug sitze. Würde ich einmal allen meinen Mut zusammennehmen und jemanden finden, der/die mit mir kommt, würde ich gerne nach Grönland reisen und von dort aus mit einem Helikopter über die Eisflächen Grönlands fliegen, mich von dem weiß-bläulichen Glanz für immer betören lassen, bevor die globale Erwärmung Grönland nach und nach vom Eis befreit.
Sie, liebe Mrs. Roosevelt, hätte ich mir als Begleitung gut vorstellen können.
Danke für Ihr Engagement für diese Welt.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 14
Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.
Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.
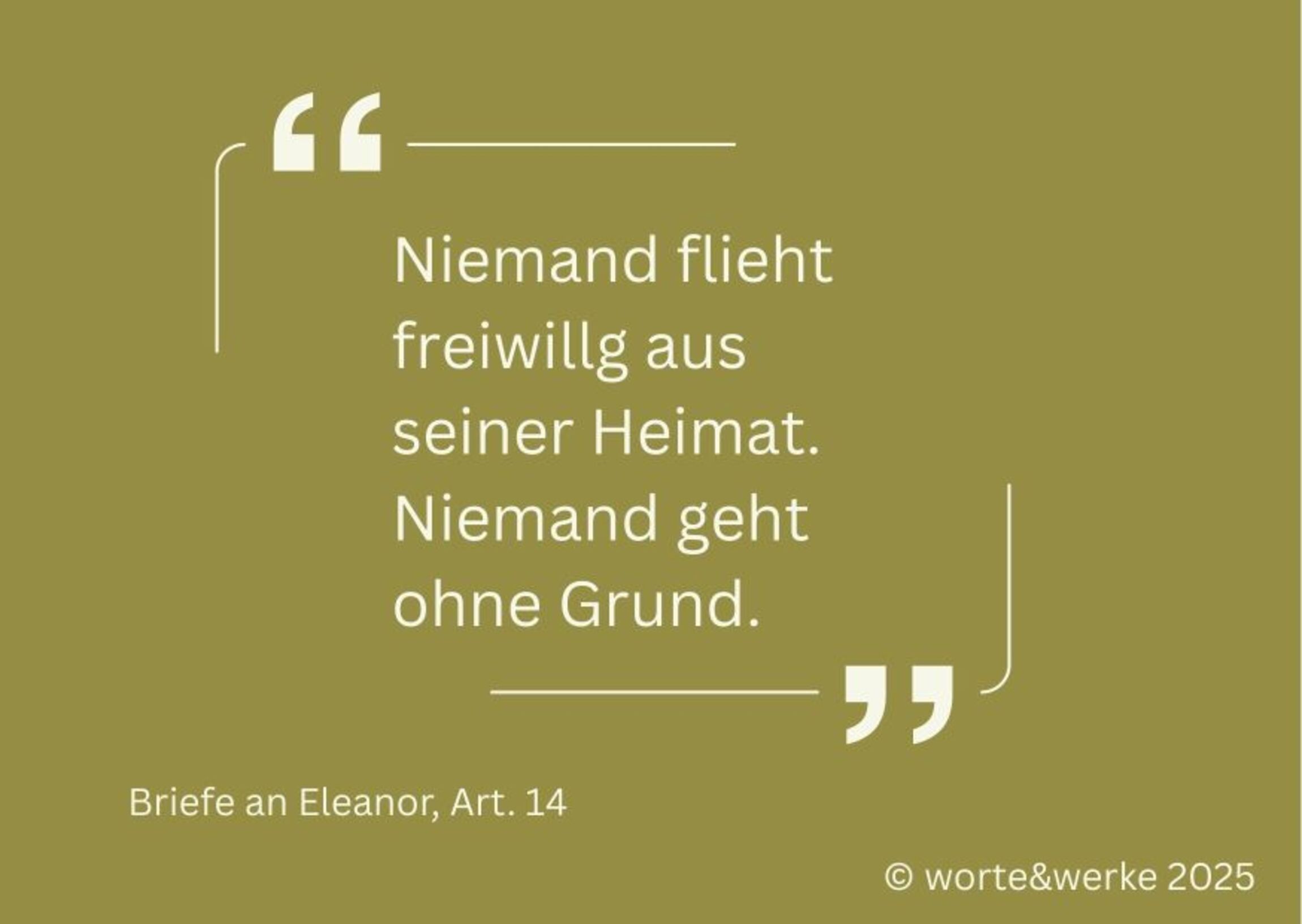
Sittensen, den 13.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
ich schreibe Ihnen heute aus einer großen persönlichen Erschütterung.
Wir haben hier im Jahre 2025 in Deutschland ein Problem. Wir nennen es „Migrationsproblem“. Die Rede ist – sie werden es schnell erkannt haben – davon, dass es zu viele Menschen gibt, die aus den unterschiedlichsten Gründen nach Europa und jetzt speziell auch nach Deutschland fliehen. Einige meinen, sie wollen nur unser Geld. Andere sagen, dass sie nach Deutschland kommen, um sich die Zähne machen zu lassen.
Eine Flüchtlingsroute nach Deutschland führt über das Mittelmeer. Seit 2014 ertranken dort über 32.000 Menschen. Es gibt Leute, die sagen: „Die können ja zu Hause bleiben. Sie sind selbst schuld.“ Mittlerweile fliehen Menschen über den Atlantik. Was für ein wahnsinniges Unterfangen…
Während ich Ihnen das schreibe, merke ich wie mein Puls steigt. Was wir in unserem Land verloren haben, ist der Sinn für Barmherzigkeit. 2015 haben wir noch Schilder geschrieben auf denen stand: „Refugees welcome!“ Heute wird unsere Menschlichkeit zugedeckt von der Sorge, dass das Land auseinanderbricht, wenn wir das „Migrationsproblem“ nicht beheben. Dafür gibt es jetzt mehr Grenzkontrollen, ein Rückführungsgesetz, und der Familiennachzug für Geflüchtete soll ausgesetzt werden. Wollen Sie sich selbst ein Bild machen? Dann empfehle ich Ihnen den Film „Kein Land für Niemand“.
Erinnern Sie sich noch an die „Exodus“? Ein Schiff, das 1947 über das Mittlermeer fahren und bis zu 5000 Juden aus Frankreich nach Palästina bringen wollte. Diese Menschen haben vorher in Europa um ihr Leben gebangt. Sie, die Familienangehörige und Freunde an Orten wie Auschwitz und Theresienstadt verloren hatten, wollten eine neue Heimat finden. Einen Zufluchtsort. Nichts anderes bedeutet das Wort „Asyl“. Ein Recht auf Asyl zu haben, so wie Sie es in den Menschenrechten erklären, heißt doch an einem Ort ankommen zu dürfen, der Schutz gibt.
Die „Exodus“ sollte die geretteten Juden ursprünglich nach Palästina bringen, das damals unter britischer Verwaltung stand. Aus diesem Plan wurde nichts, da das Schiff von britischen Marineschiffen angegriffen wurde, um einen Einreisestopp für Juden nach Palästina durchzusetzen. Mit Gewalt wurden die Flüchtlinge auf drei andere Schiffe umgeladen und zurück nach Frankreich geschickt. Weil sich die Flüchtlinge dort weigerten an Land zu gehen, fuhren die Schiffe weiter in das von Briten besetzte Hamburg. Von britischen Soldaten wurden sie dort an Land geprügelt. An den Ort ihrer schlimmsten Lebenserfahrungen. Seit 1946 wurden über 50000 Juden auf ihrer Flucht nach Palästina abgefangen und wieder nach Europa deportiert. Was für ein Drama.
Liebe Mrs. Roosevelt, zu Ihrer Zeit flohen die Menschen aus Europa auf andere Kontinente, heute ist es umgekehrt. Damals wie heute gilt: Niemand flieht freiwillig aus seiner Heimat. Niemand geht ohne Grund. Jeder und jede Geflüchtete hat eine eigene Geschichte. Eine Geschichte von Demütigung oder Verfolgung, von Krieg oder anderen Katastrophen. Ich habe einen kleinen Jungen kennengelernt. Er war sechs Jahre alt und hatte schon die Flucht übers Mittelmeer aus Aleppo hinter sich. Mittlerweile ist er seit 10 Jahren in Deutschland. Er hat die Schule besuchen können. Macht jetzt vermutlich eine Ausbildung. Es kann also gelingen.
„Jeder Mensch hat ein Recht auf Asyl.“ Ich danke Ihnen für diese Worte. Wie sie umgesetzt werden können, weiß ich nicht. Viele reden davon, dass Kapazitätsgrenzen erreicht sind und manche Kommune unter der hohen Zahl der Geflüchteten ächzt.
Vielleicht sollten wir sie mehr nach ihrer Geschichte fragen, nach ihren Beweggründen. Vielleicht würde das etwas mit unserer Menschlichkeit machen. Vermutlich würde es uns weicher machen und die Härte mit der wir gerade in Deutschland gegen unser „Migrationsproblem“ vorgehen verwandeln.
Liebe Mrs. Roosevelt! Man lässt doch keinen Menschen ertrinken. Und man weist doch nicht einfach Menschen an den Grenzen ab ohne die Umstände zu prüfen und nach der Geschichte und den Beweggründen zu fragen.
Ich gestehe, ich habe keine Antwort. Aber ich will nicht aufhören, zu hoffen, dass der Wind sich wieder dreht. In Richtung Menschlichkeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 15
Jeder Mensch hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
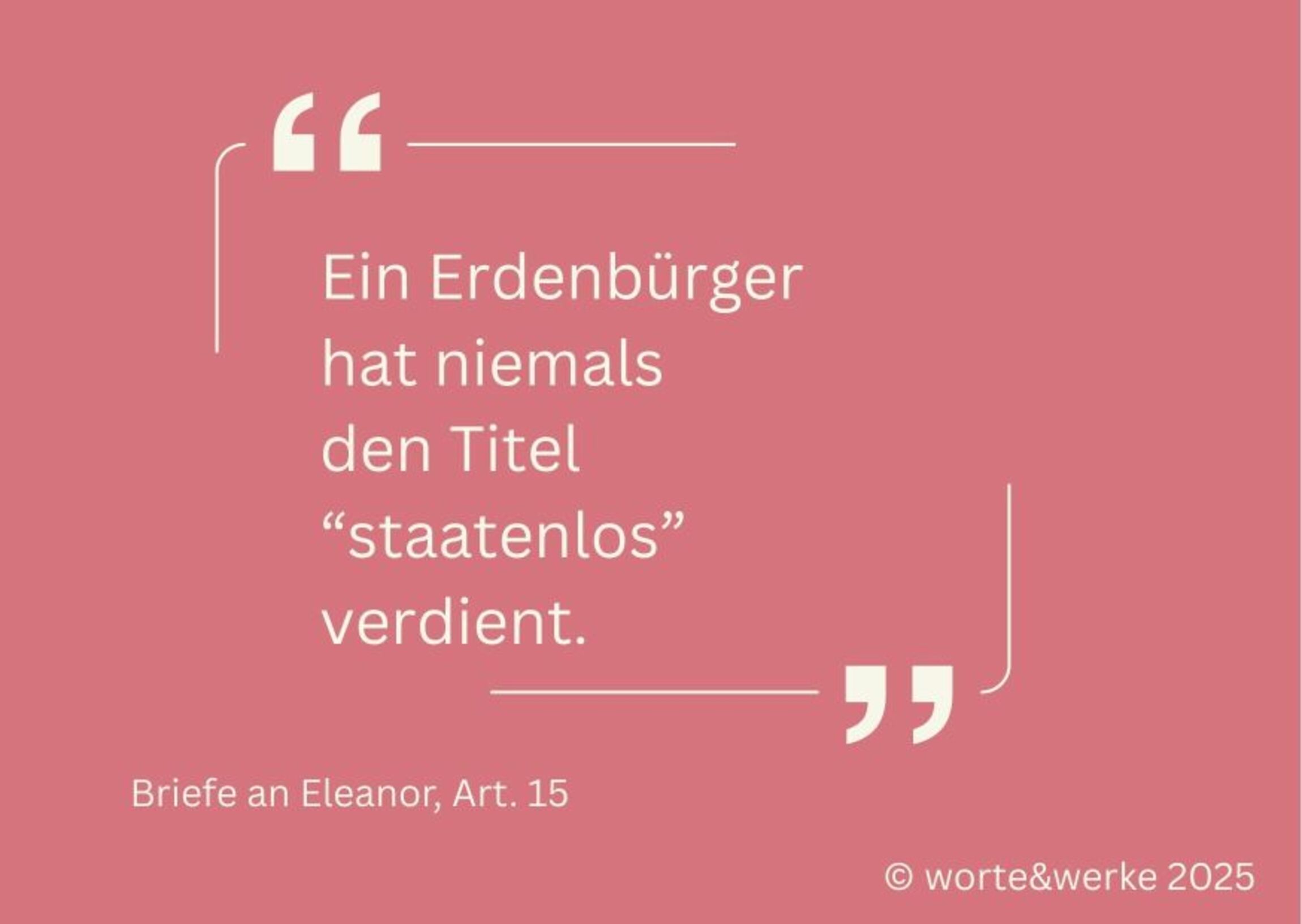
Sittensen, den 15.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
ich besitze seit meiner Geburt im Jahre 1962 die deutsche Staatsangehörigkeit. Erst hatte ich nur einen Kinderausweis ohne Foto. Dann einen Kinderausweis mit Foto. Dann einen Personalausweis mit grauem Umschlag. Jetzt trage ich eine kleine Checkkarte in meinem Handy mit mir herum. Aber egal, wie sich das Äußere dieses Ausweises verändert. Der Inhalt ist derselbe. Ich bin Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland. Mein Pass kann mir nicht entzogen werden, er zeichnet mich aus. Verspricht mir Heimat und Schutz.
Manchmal hätte ich gerne einen Pass in dem „Erdenbewohner“ drin steht. Diese Idee habe ich von einer jungen Sängerin übernommen. Würde das nicht Vieles einfacher machen, wenn alle einen Pass hätten auf dem „Erdenbewohner“ steht? Würde es nicht die vielen Unterschiede und unüberwindbaren Grenzen zwischen Menschen kleiner und überwindbarer machen? Was halten Sie davon?
In Deutschland gibt es einfache, doppelte Staatsangehörigkeit und auch dreifache Staatsangehörigkeit. Wird zum Beispiel ein Kind in Deutschland geboren und hat einen deutschen Vater und eine ausländische Mutter, dann kann es von Geburt an zwei Staatsangehörigkeiten haben. Oder ein anderes Beispiel: Ein Kind wird im Ausland geboren und hat Eltern mit zwei unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten. Nun wird es in Zukunft in Deutschland leben und möchte die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Viele rechtliche Schritte sind nötig und es kann einen sehr langen Zeitraum dauern. Entscheidungsprozesse dauern Jahre. Aber es ist möglich.
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Die Angelegenheit muss langsam reifen, frei von scharfen Ecken.“ Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Scharfe Ecken möchte niemand. Aber langes Warten zermürbt auch und macht unsicher.
„Jeder Mensch hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemandem darf die eigene Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden die Staatsangehörigkeit zu wechseln.“ Art.15
Ich bin sehr froh und dankbar, dass mir niemand einfach so meinen Pass wegnehmen und meine Staatsangehörigkeit absprechen kann. Ich habe mein Zuhause in Deutschland.
Liebe Mrs. Roosevelt, aber es gibt noch ein Problem. Das macht mich ratlos. Menschen kommen ohne Pass als Geflüchtete in Europa an. Es gibt viele „Staatenlose“ und eigentlich darf in Deutschland niemand ohne Pass leben.
Personen ohne gültige Ausweise haben es schwer. Sie können ihre Rechte auf Bildung oder auf soziale Versorgung oder Gesundheitsversorgung kaum wahrnehmen. Ich habe neulich von einer Frau gehört, die in einer Arztpraxis mit den Worten weggeschickt wurde: „Jemanden wie sie behandeln wir hier nicht…“
Sie sehen mich fassungslos meinen Kopf schütteln. Zum Glück gibt es Organisationen, die Staatenlosen weltweit helfen, wenn es zum Beispiel um die medizinische Versorgung geht. Aber es ist ein sehr leidvolles Kapitel.
„Worte sind schon grausam“, sagte mir eine Freundin mit der ich über meinen Brief an Sie sprach. Und: „Ein Erdenbürger hat niemals den Titel ‚staatenlos‘ verdient.“ So ihre Worte, die mich sehr angerührt haben.
Was denken Sie über dieses Problem? Ich frage Sie, obwohl Sie keine Juristin sind. Ich übrigens auch nicht. Ich frage Sie als sehr erfahrene Diplomatin.
Und was, liebe Mrs. Roosevelt, halten Sie von der Idee, dass wir alle nur noch „Erdenbürgerpass“ haben. Ausnahmslos. Alle?
Fragen über Fragen. Ich grüße Sie.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 16
Volljährige Menschen haben ohne jede Beschränkung auf Grund von rassistischen Zuschreibungen, aufgrund der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.
Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden.
Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
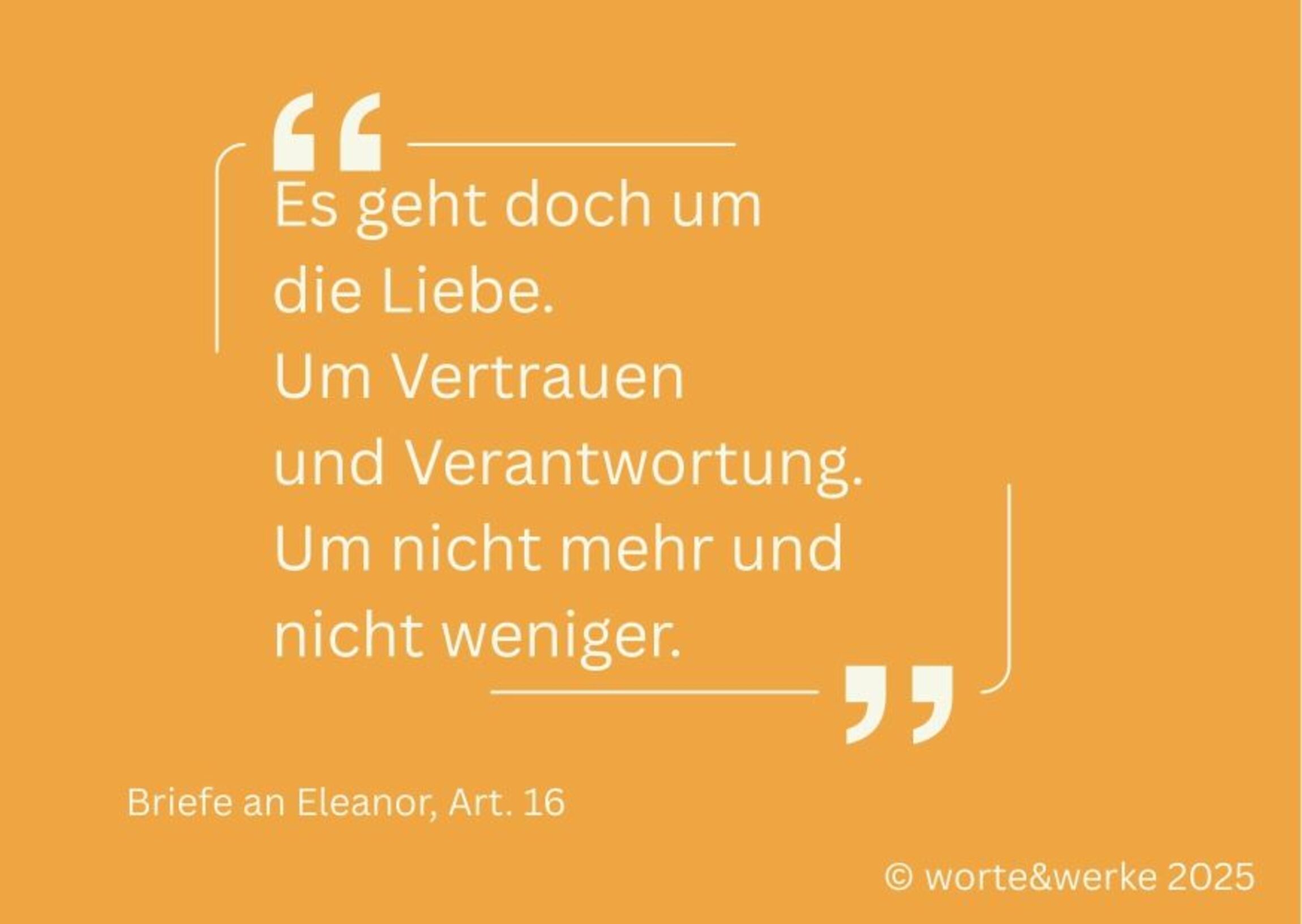
Sittensen, den 16.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
es ist Samstag. Ich brauche etwas Ruhe, um Ihnen heute zu schreiben, denn das Thema über das ich mit Ihnen reden möchte, sorgt in unserem Land seit einigen Jahren immer wieder für Diskussionen. Es gibt Differenzen in der Beurteilung des Sachverhaltes.
Sie schrieben 1948 von der Gleichheit zwischen Männern und Frauen, über die Gleichbehandlung im Fall von Scheidung. Sie schrieben, dass jeder heiraten kann, wen er möchte – ohne die Frage nach der Staatszugehörigkeit oder Religion. Und Sie betonten, dass die Familie die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft ist.
Ich habe diese Sätze in den letzten Wochen sehr, sehr oft gelesen. Ich habe mich gefreut über Worte wie „Schutz“ und „gleiche Rechte“. Dann bin ich doch wieder über Formulierungen gestolpert, wie z.B. „natürliche Grundeinheit“. Ich suchte nach Worten, die ehrlich sagen, wie es mir mit diesem 16. Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geht, so wie Sie ihn mit Ihrer Kommission formuliert haben.
Zuallererst, möchte ich Ihnen schreiben, dass mich im Lesen der Menschenrechte Ihr Ringen um Gleichheit der Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion immer wieder neu beeindruckt. Es sagt doch allen: „Das Leben, das du lebst, gehört dir.“ Und hinter dieser Botschaft steht so viel Respekt, Wertschätzung, Wahrnehmung der Würde, Ermunterung zur Selbstannahme im Blick auf den einzelnen Menschen.
Wenn es um das Thema „Liebe“ geht, scheiden sich die Geister und erhitzen sich die Gemüter. Insbesondere wenn es um gleichgeschlechtliche Liebe geht. Zu ihrer Zeit, war ganz deutlich definiert, dass es sich bei den Worten „Liebe“ und „Ehe“ allein um die Liebe und eheliche Beziehung zwischen Frauen und Männern handeln kann. Ihnen war wichtig, dass Frauen die gleichen Rechte bekamen wie Männer. Dass sie sowohl bei der Eheschließung als auch bei einer Scheidung nicht benachteiligt werden sollten. Ihre Erfahrungen aus Beobachtungen und in Gesprächen mit Frauen werden Sie dazu bewogen haben.
Eheschließung waren zu Ihrer Zeit nur zwischen Frauen und Männern möglich. Sie selbst mussten Ihre gleichgeschlechtliche Beziehung in der Öffentlichkeit verstecken. Ich denke, das war sehr schwer und oft auch sehr konfliktreich für Sie.
Die Zeiten haben sich geändert. Seit 2017 können in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Und das ist gut so. Ich sage es nicht ohne Grund. Es geht doch bei Liebe immer um Vertrauen. Es geht um Verantwortung füreinander. Und so dürfen nun Frauen Frauen lieben. Ein Mann darf einen Mann lieben. Und sie dürfen ihre Liebe im öffentlichen Raum zeigen. Dass homosexuelle Partnerschaften nun auch gesetzlich anerkannt werden, und Paare heiraten dürfen, das ist vielen Menschen zu verdanken, die nicht länger schweigen wollten. Sie setzten sich für diese Gesetzesänderung ein und kämpften für ihre eigene Liebe oder die Liebe anderer Menschen.
Eine Ehe ist auch heute nur anerkannt, wenn sie vor einem Standesamt geschlossen wird. Daran hat sich nichts geändert. Dazu braucht es bestimmte Papiere und Unterlagen. Niemand darf heiraten, der im selben Moment schon verheiratet ist. Um heiraten zu können, muss jemand volljährig und ehefähig sein. Eheschließungen zwischen Verwandten bestimmter Grade sind nicht erlaubt. Innerhalb eines bestimmten Reglements dürfen Menschen also heiraten, wen sie möchten.
Sie liebe Eleanor, hatten besonders die Frauen im Blick. Sie sollten im Fall einer Trennung die gleichen Rechte wie die Männer haben. Niemand sollte zu einer Ehe gezwungen werden. Sie schreiben über den Schutz der Familie. Sie benennen besonders die Verantwortung, die ein Staat gegenüber Familien hat.
Was ist „Familie“? Heute verbirgt sich hinter diesem Wort schon lange nicht mehr allein das traditionelle Bild von „Vater, Mutter, Kind“. Familie ist neben der herkömmlichen Definition auch: Zwei Frauen und ihre Kinder. Zwei Männer und ihre Kinder. Ein alleinerziehender Vater, eine alleinerziehende Mutter und die dazugehörigen Kinder. Familie ist: Eltern mit Pflegekindern.
Gestern hörte ich von einer Dame, die bei der Einschulung ihres Enkels sagte: „Wir sind ja mittlerweile drei Omas… schließlich sind wir eine „Patchwork Familie“. Wie gut, dass wir uns mit unterschiedlichen Lebensmodellen anfreunden. Es hat so viel mit der Würde des Menschen und der bewussten Ablehnung von Diskriminierung zu tun. Die unterschiedlichen Familienmodelle in unserem Land sind für mich und viele eine große Bereicherung.
Liebe Eleanor, es geht doch um die Liebe. Um nicht mehr und nicht weniger. Aber nicht alle sehen es so. Deshalb möchte ich mit diesem Brief denen danken, die den Mut haben, anders zu leben. Ich möchte von ihrer Liebe lernen, die sie sich zu zeigen trauen. Ich möchte nicht aufhören, mit anderen ins Gespräch zu kommen, die besonders auch aus religiösen Motiven heraus meinen, dass das alles nicht sein darf. Schutz erfahren Menschen doch erst, wenn sie geliebt werden.
Die Künstlerin Annie Heger, die ich sehr schätze, schreibt: „Wer hofft, der sieht. Wer hofft, der liebt.“
Und daran möchte ich festhalten.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 17
Jeder Mensch hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.
Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.
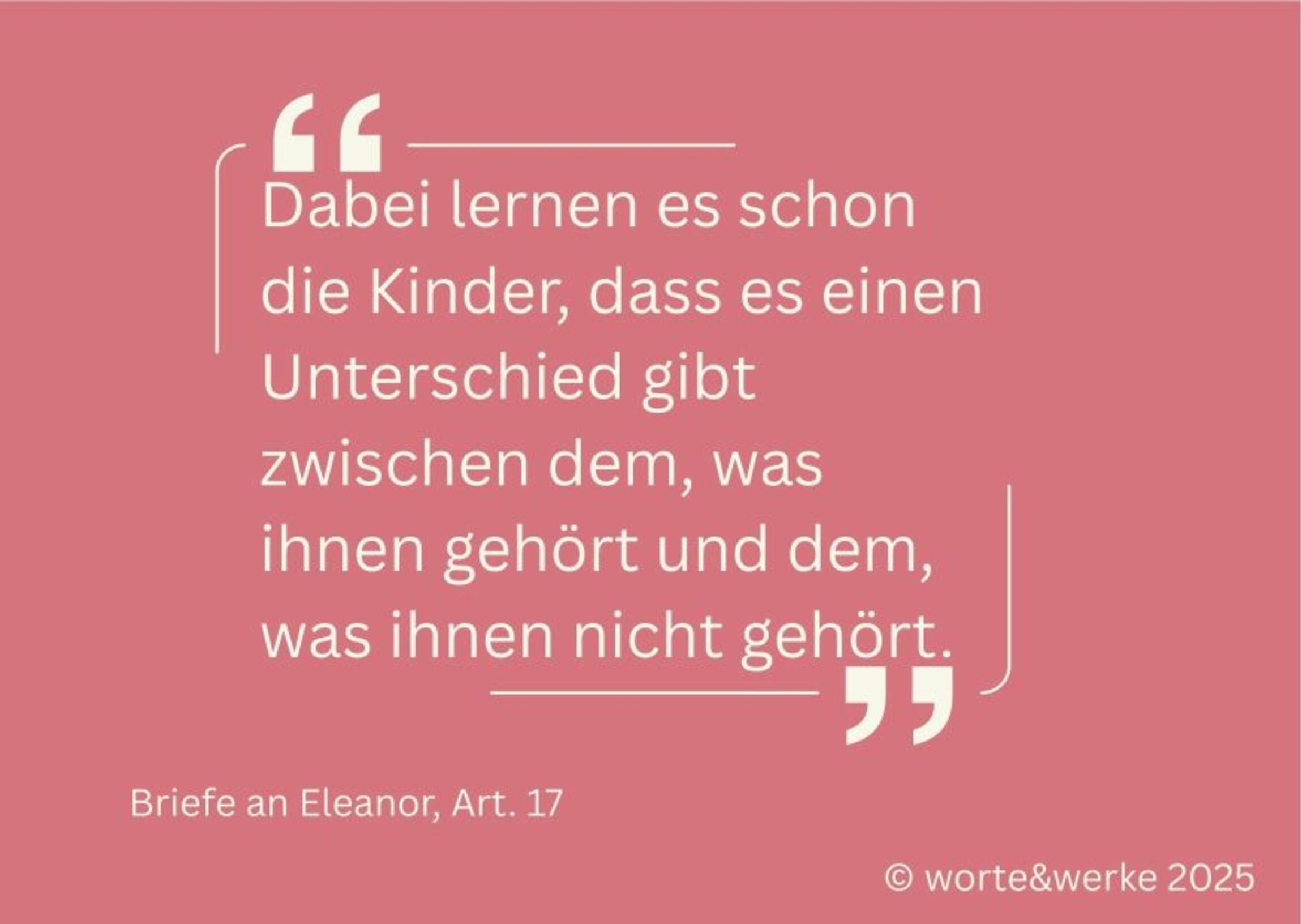
Sittensen, den 18.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
manchmal gibt es Streit über die Frage, wem etwas gehört. Es kann um kleinere Streitigkeiten in Kindertagesstätten über mitgebrachtes Spielzeug gehen. Oder: Nachbarn streiten sich um die Einhaltung der Grundstücksgrenzen. Und manches lässt sich nicht einfach außergerichtlich klären. Spanne ich den Bogen jetzt in Gedanken noch weiter, dann fallen mir auch Differenzen über territoriale Ansprüche ein, die sich in kriegerischen Auseinandersetzungen ausdrücken, so wie wir es seit 2022 in der Ukraine erleben.
Wem gehört was? Vor ein paar Monaten stellte der derzeitige amerikanische Präsident die Behauptung in den Raum, dass Grönland doch zu Amerika gehören möge. Im dänischen Parlament wurde darüber erst herzlich gelacht und dann sehr deutlich zu diesem geäußerten Besitzanspruch Stellung genommen. Dabei ist es dann erst einmal geblieben.
Wie definiert sich also das Eigentum eines einzelnen Menschen? Wie ist es geschützt und kann nicht willkürlich in den Besitz eines anderen übergehen. Sowohl im Großen als auch im kleinen Stil.
Ich habe gelesen, dass Sie, liebe Mrs. Roosevelt, mit den Männern ihrer Kommission, sehr um die Formulierung des 17. Artikels der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gerungen haben. Ideologisch waren sie doch sehr weit voneinander entfernt. Im Laufe Ihrer Gespräche haben sie sich dann miteinander auf die folgende Formulierung verständigen können:
„Jeder Mensch hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft, mit anderen Eigentum innezuhaben. Niemand darf willkürlich des Eigentums beraubt werden.“ Art. 17
Dieses Recht ist so gut und so wichtig. Es sollte vor staatlicher und privater Willkür schützen. Davon hatten Sie alle, die sie in der Kommission saßen, aus der eigenen Geschichte genug bestürzende und mahnende Beispiele vor Augen.
Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen das Eigentum wegzunehmen. Schön denke ich, wenn ich von Europa wegsehe und zum Beispiel nach Uganda oder Indien schaue. Kastenlose haben dort schon einen Rechtsanspruch auf Eigentum. In der Umsetzung ist es aber trotz des Schutzes vor Diskriminierung nicht möglich. Es gibt „kastenbasierte Diskriminierung“, die den Besitz von Boden für Kastenlose schier unmöglich macht. Ich lese über Landraub und Aneignung des Besitzes armer Landeigentümer durch Regierungen und Konzerne. Es gibt keine angemessenen Abfindungen. Warum um alles in der Welt wollen die, die viel haben noch viel mehr haben und entrechten dafür die offensichtlich Schwächeren? Ich frage Sie.
Dabei lernen es schon die Kinder, liebe Mrs. Roosevelt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ihnen gehört und dem, was ihnen nicht gehört. Es ist ein wichtiges Ziel der Pädagogik, dass Kinder lernen, „mein und dein“ zu unterscheiden.
Ein Mensch, dem etwas gehört, wird versuchen dafür Verantwortung zu übernehmen. Ein Beispiel: Jemand, der ein Haus baut oder kauft und dessen Besitz im Grundbuch eingetragen ist, wird sich nach seinen Kräften um das Gebäude, um den Wohnraum oder um das Grundstück kümmern. Dazu ist er laut Gesetzgebung auch verpflichtet. „Eigentum verpflichtet!“, pflegte mein Onkel immer zu sagen und ging dann in den Garten, um sich um die Obstbäume zu kümmern.
Eigentum ist mehr als eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück. Mehr als Geld. Es ist mehr als ein Auto oder bewegliches und unbewegliches Inventar, welches im Falle des Todes an die Nachkommen vererbt wird. Menschen können nie Eigentum eines anderen Menschen sein. So ist es in der westlichen Welt. In anderen Kulturen können Frauen bis heute noch zum Eigentum ihres Mannes gehören. In diesem Fall bezeichnet der Begriff „Eigentum“ dann, dass der Mann die Verfügungsgewalt über die Frau hat. Ist das nicht eine fatale Vorstellung, Mrs. Roosevelt?
Ich denke über immaterielles Eigentum nach. Denn Eigentum ist auch das, was ich in meinem Beruf an Texten verfasse. Zum Beispiel dieser Brief oder Musik, die ich komponiere. Bücher, die ich veröffentliche. Bilder, die gemalt werden. Kunstwerke, die entstehen und ausgestellt werden. Es gibt durch das Urheberrecht geschütztes Eigentum. Eine ganze Branche benötigt diesen Schutz. Patente schützen technischen Fortschritt, Entwicklungen und Erfindungen. Auch dieses Eigentum darf nicht willkürlich von jemandem beansprucht werden. Auch nicht von Regierungen.
Liebe Mrs. Roosevelt, ich gestehe, ich gehöre zu den Menschen, die viel haben. Ich genieße es und darf es auch genießen. Aber wenn die Bilder und Nachrichten mich durch die Medien erreichen, empfinde ich es als ungerecht, dass Besitz, Eigentum und auch Vermögen weltweit so ungerecht verteilt sind. Gibt es auf dieser Welt doch so viele Menschen, denen Eigentum verwehrt bleibt. Darum hoffe ich, dass wer besitzt, auch gerne teilt.
Ich grüße Sie aus dem sommerlichen Norddeutschland.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 18
Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
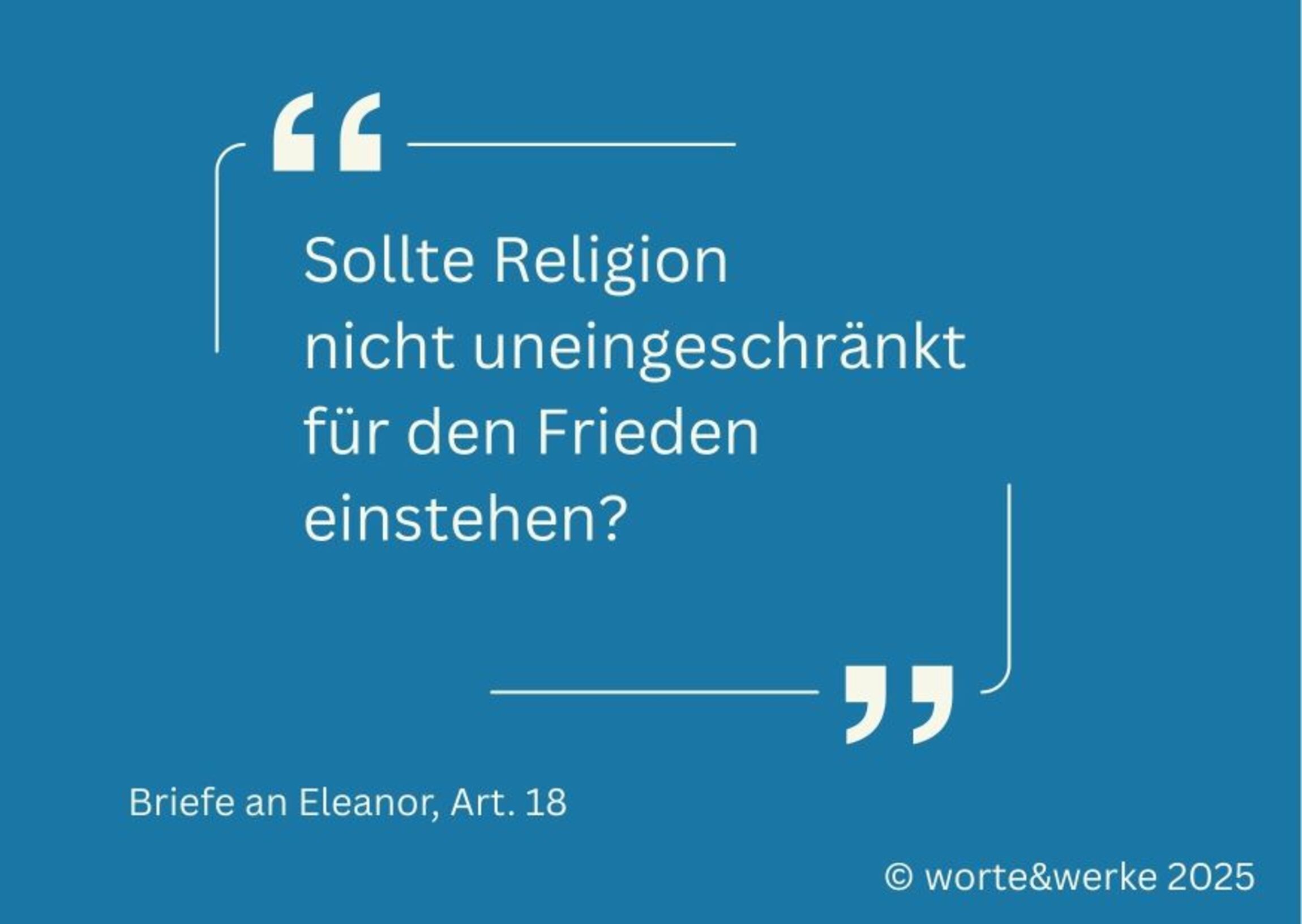
Sittensen, 20.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt,
eine meiner besten Freundinnen in der Grundschule war ein Mädchen muslimischen Glaubens. Sie hieß Mitra. Wir verstanden uns gut. Ihr Vater war als Arzt aus dem damaligen Persien geflohen. Ich wusste nicht, was sie glaubte, nur, dass sie nicht an den Gott der Christen glaubte. In meinem Elternhaus wuchs ich mit dem christlichen Glauben und der dazugehörigen Tradition auf. Fremde Religionen galten als irgendwie „böse“. Ich sollte mich auf jeden Fall von ihnen fernhalten.
Sie kennen das aus Ihrer eigenen Geschichte. Sie wuchsen als Kind wohlhabender weißer, protestantischer Eltern anglo-amerikanischer Abstammung auf. Ihre Familie gehörte damit zu einer Gruppe, die immer zur Oberschicht ihres Heimatlandes gehörte. Soziologen haben für Ihre Herkunft den Begriff White Anglo-Saxon Protestant geprägt. Die WASP hielten sich selbst für eine Elite und grenzten sich von Menschen anderer Herkunft ab. Ausgegrenzt und abgewertet wurden Personen mit dunkler Hautfarbe, jüdischer Herkunft und auch Katholiken. Sie alle wurden in Ihrer Gemeinschaft als fremd empfunden. Wären Sie, liebe Mrs. Roosevelt, damals auf die Idee gekommen, einen Menschen aus einer dieser Personengruppen zu heiraten, wäre Ihnen das verwehrt worden. Niemand aus diesen Gruppen konnte zu ihrer Gemeinschaft hinzukommen. Sie sind immer Teil dieser gesellschaftlichen Gruppe gewesen, aber Sie haben sich im Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen eine eigene Meinung gebildet und diese auch vertreten. So konnten Sie für sich auch manche religiöse Vorbehalte überwinden.
Gerne würde ich mich mit Ihnen darüber unterhalten, wie Sie es geschafft habe, sich eine eigene Meinung zu bilden und aus der gedanklichen Enge herauszutreten. Ich würde Ihnen dann auch gerne meine persönliche Geschichte erzählen.
Religionsfreiheit – was für ein wertvolles Wort. In Deutschland versuchen wir diese Freiheit zu leben. Wir dürfen wählen, ob und welcher Religionsgemeinschaft wir angehören wollen. Wir dürfen unseren Glauben frei und öffentlich bekennen. In anderen Ländern weltweit gelingt das leider nicht. Dort gibt es Angriffe und Einschüchterungen bis hin zu Verfolgung und Tod bei der Ausübung des eigenen Glaubens - und damit meine ich nicht explizit die Ausübung des christlichen Glaubens.
In Deutschland gibt es sehr viele verschiedene religiöse Gemeinschaften. Ich erspare Ihnen hier das Aufzählen von Namen und Zahlen. Wir wissen uns der religiösen Vielfalt in unserem Lande verpflichtet. Für uns in Deutschland ist sie Beides: Eine große Herausforderung und eine große Bereicherung. Ein wichtiger Bestandteil, der zur Stabilisierung unserer Gesellschaft beiträgt ist, dass wir die anderen Religionsgemeinschaften achten. Es werden Moscheen gebaut, es gibt buddhistische Tempel und Klöster, jüdische Synagogen in verschiedenen Städten und christliche Kirchen. Und vieles an religiösen Einrichtungen könnte ich aufzählen.
Es gibt den interreligiösen Austausch und gemeinsam gefeierte Gottesdienste. Es gibt Freundschaften, Trauungen zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen. Niemand soll wegen seines/ ihres Glaubens verachtet und verurteilt werden.
Und trotzdem gibt es auch das andere: Politisch oder religiös motivierte Anschläge und Übergriffe auf Menschen, die anders glauben und ihren Glauben leben. Das tritt in den letzten Monaten leider vermehrt auf. Die Gesellschaft spaltet sich zunehmend und diese Anschläge befeuern die Spaltung in ein „wir“ und „die anderen“.
Sicher hat es auch etwas damit zu tun, dass wir die Integration von Geflüchteten nicht in den Griff bekommen. Und es gibt in allen Religionen diejenigen, die sich nicht dem Frieden und der Barmherzigkeit verpflichtet wissen, sondern durch Vorurteile zu schlimmen Taten und bösen Worten fähig sind. Das ist sehr traurig.
Ich frage Sie Mrs. Roosevelt Sollte Religion nicht uneingeschränkt für den Frieden einstehen? Stehen die Religionen nicht alle für Barmherzigkeit?
„Ist es möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ Ich zitiere hier Paulus, der das einmal an die Christen in Rom geschrieben hat.
Die Erinnerung an den Frieden wäre ein großer Schritt im Miteinander der Menschen in aller Welt, unabhängig ihrer religiösen und kulturellen Hintergründe. Lassen Sie uns nicht müde werden, davon zu reden und dafür zu beten.
In diesem Sinne einen herzlichen Gruß.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 19
Jeder Mensch hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
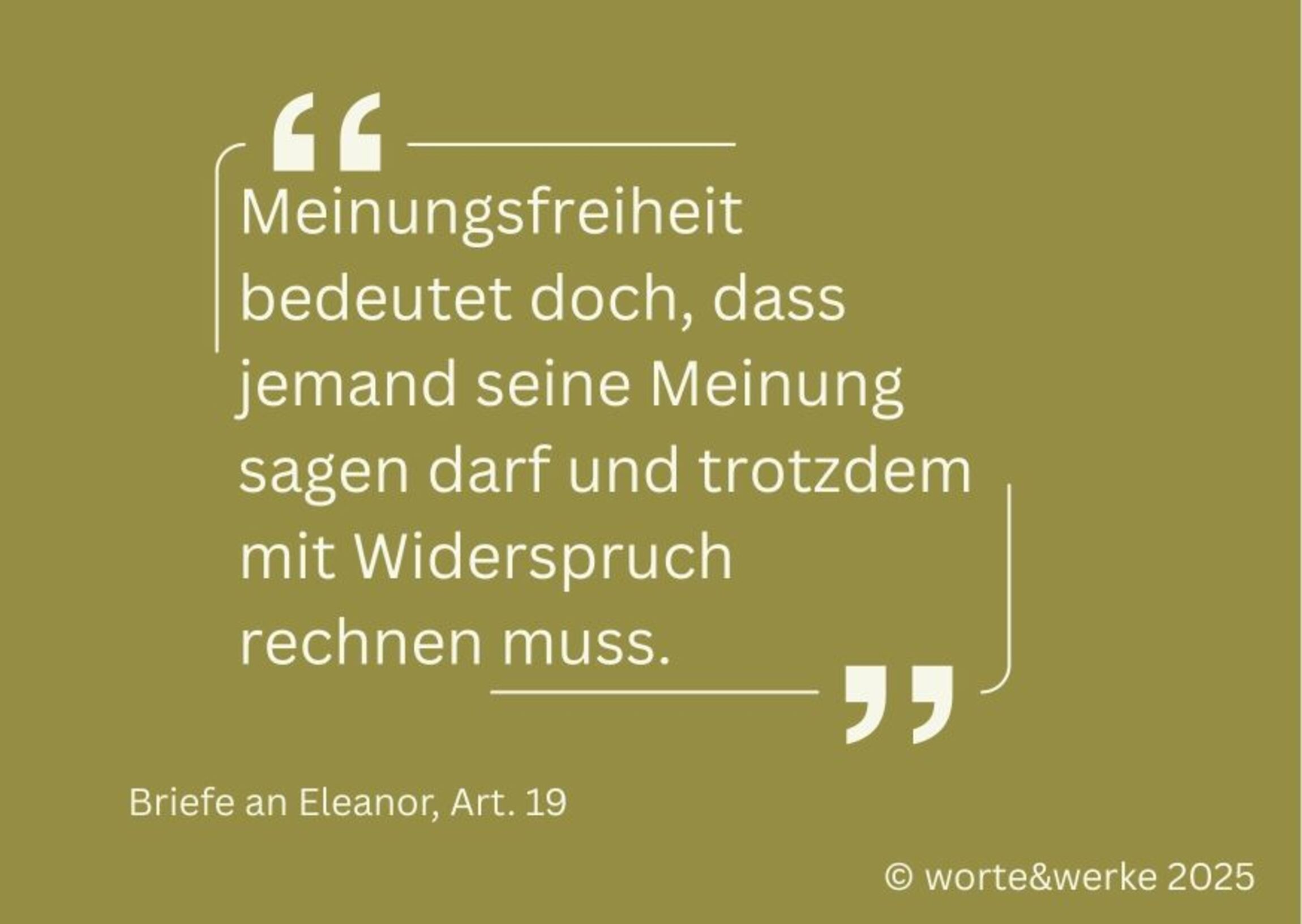
Sittensen, den 21.08.2025
Liebe Mrs. Roosevelt!
Es gibt Tage, an denen mir der Kopf schwirrt. In der Regel sind das die Tage, an denen sich die Nachrichten überschlagen. Voll mit Meldungen über Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. Mein Eindruck ist, dass manche Menschen immer unanständiger werden, weil sie andere Menschen sprachlich herabsetzen. In den sozialen Medien wird so massiv beleidigt, dass es „zum Himmel schreit“.
Nicht wenigen Zeitgenoss*innen fehlt es an Anstand. Sie verbreiten menschenfeindliche Parolen und widerlichen Hass. Ich finde es erschütternd zu lesen und zu hören, wie übergriffig und verletzend Lebenskonzepte kommentiert werden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Gestern sah ich eine Sendung über ein lesbisches Pastorenehepaar meiner Landeskirche. Als sie ein Kind erwarteten, kommentierte jemand die Schwangerschaft in den sozialen Medien mit dem Satz: „Ich wünsche dein Kind kommt behindert zur Welt.“ Da fehlen mir nicht nur die Worte. Nein, da nimmt es mir die Luft zum Atmen. Was – um alles in der Welt – ist mit Menschen los, die eine Schwangerschaft so kommentieren? Woher kommt der Hass und woher kommt dieser Gedanke, dass ich alles in jeglicher Art kommentieren darf, egal wie verachtend und verletzend der Inhalt einer Rede ist?
Meinungsfreiheit ist ein Recht, dessen Wert wir nicht hoch genug einschätzen sollten. Wir sehen doch in anderen Ländern, was geschieht, wenn wir nicht mehr unsere Meinung sagen dürfen. Ich schrieb Ihnen bereits darüber.
Aber Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Zum Beispiel dort, wo Persönlichkeitsrechte einzelner durch rassistische, sexistische und andere Beleidigungen verletzt werden. Dort, wo Menschen in Kommentaren und Symbolen verachtet werden. Dort, wo die Meinungsfreiheit sich aufschwingt, um volksverhetzende Parolen erklingen zu lassen und durch das Land zu tragen. Symbole aus der Nazizeit sind verboten, Hitlerrufe sind verboten. Selbst darüber gibt es jetzt leider schon kontroverse Debatten in der Weise, ob das nicht etwas übertrieben sei.
Eine Umfrage im Jahr 2023 hat ergeben, dass nur noch 40 % aller Befragten glauben, dass sie in Deutschland ihre Meinung frei und unbehelligt sagen können. Ich vermute in 2025 wird es einen noch niedrigeren Wert geben. Die Menschen sind verunsichert, liebe Mrs. Roosevelt oder darf ich lieber „Eleanor“ sagen?
Fragen Sie sich vielleicht auch, woran das liegen könnte? Einige Beobachter*innen und Kommentator*innen schreiben, dass es derzeit politische Kräfte gibt, die bei lautstark geführten Disputen die Bürgerinnen und Bürger verunsichern. Sie suggerieren in ihren Reden, ein Abhandenkommen der Meinungsfreiheit im Blick auf unsere Gesellschaft. Oft verbirgt sich hinter diesen Reden der Gedanke, dass es keinen Widerspruch gegen die von ihnen verbreiteten Meinungen geben darf und dass sie im Recht seien.
Aber Meinungsfreiheit bedeutet doch, dass jemand seine Meinung sagen darf und trotzdem mit Widerspruch rechnen muss. Eine Politikerin sagte bei einer Debatte über die Meinungsfreiheit einmal: „Meinungsfreiheit beinhaltet kein Recht auf keinen Widerspruch.“
Liebe Eleanor, noch dürfen wir hier in unserem Land unsere Meinung frei sagen. Wir dürfen auf die Straße gehen, wir dürfen demonstrieren. Wir werden nicht inhaftiert, wenn wir etwas an der Regierung kritisieren. Das sieht in anderen Ländern schon ganz anders aus. Mich beunruhigt, dass gerade die Kräfte, die den Verlust der Meinungsfreiheit anprangern, in ihren Gedanken und Aussagen selbst oft populistisch oder fragwürdig unterwegs sind.
Ich wünsche mir, dass sich unsere Gesellschaft auch im Blick auf die Meinungsfreiheit daran messen lässt, was anderen guttut und sie fördert. Ich befürworte, dass wir uns entschieden dem entgegenstellen, was Menschen beleidigt, ausgrenzt und in widerlicher Art und Weise verurteilt. Und ich weiß, dass wir benennen müssen, wenn Unrecht gegen Menschen geschieht, wie wir es derzeit im Gazastreifen erleben. Mittlerweile gibt es dort über 61000 Tote und über 151000 Verletzte. Ich weiß, dass diesen Konflikt, der nach einem furchtbaren Angriff auf die israelische Zivilbevölkerung begann, viele Menschen anders sehen, als ich es Ihnen schreibe. Aber ich mache Gebrauch von der Freiheit meine Meinung zu äußern. Man lässt doch keine Menschen verhungern. Wie viel dringender brauchen sie Grundnahrungsmittel als Raketeneinschläge.
Liebe Eleanor, wie ich schon sagte: Wir leben in keinen leichten Zeiten. Furcht ist eine große Kraft, denke ich. Aber Liebe auch. Eine sehr große Kraft. Dafür sollten wir uns einsetzen. Dass sich Liebe und Verständnis in dieser Welt ausbreiten.
Mit diesen Worten grüße ich Sie für heute ganz herzlich.
Ihre Claudia Meyer
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 20
Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
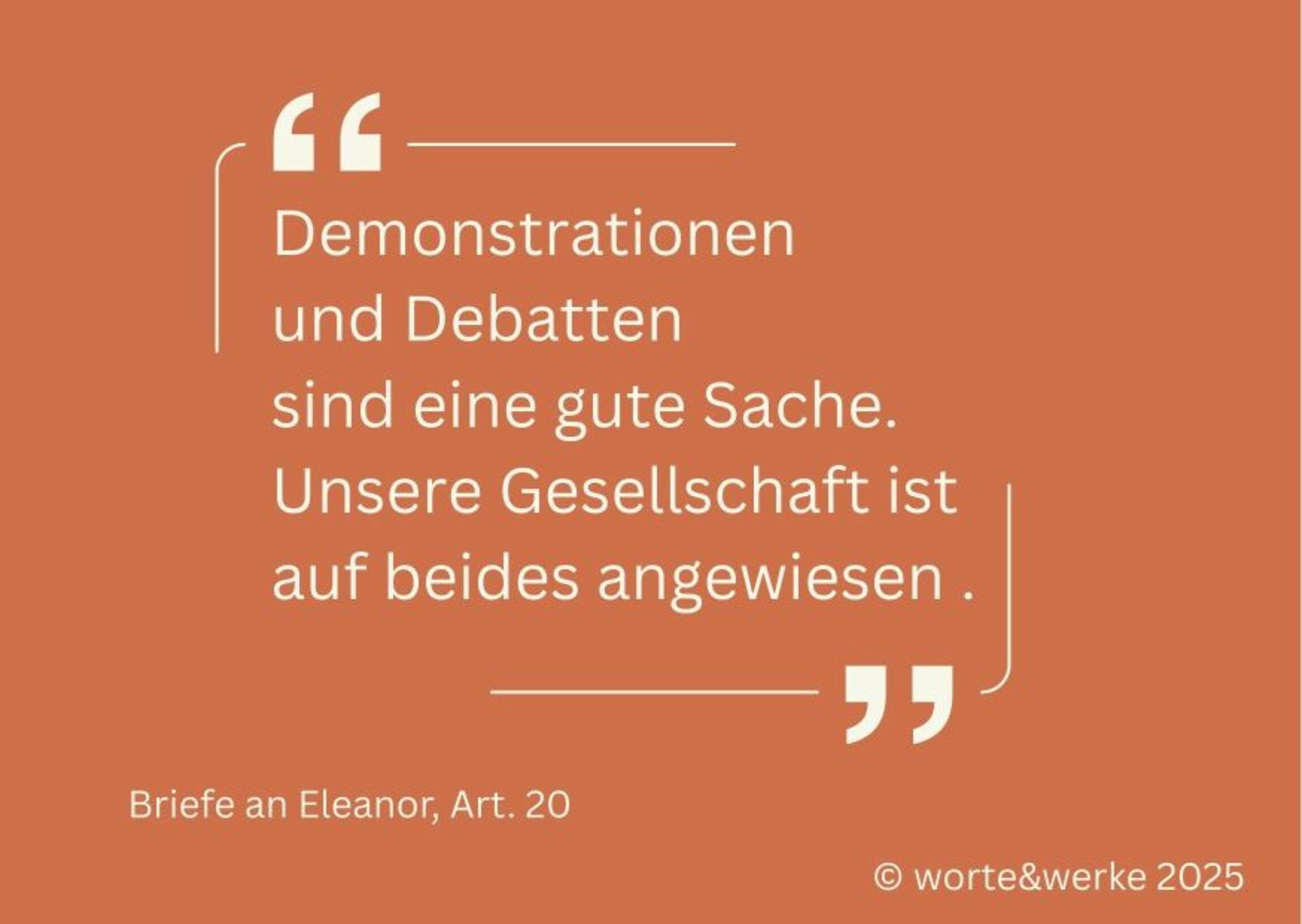
Sittensen, den 23.08.2025
Liebe Eleanor,
bitte verzeihen Sie mir noch einmal diese sehr persönliche Anrede. Aber nach 19 Briefen, die ich Ihnen mittlerweile geschrieben habe, fühle ich mich Ihnen sehr nah. Manchmal wünsche ich mir, wir würden uns an einem Abend bei einem netten Essen begegnen und reden und reden und reden. Pläne schmieden. Leidenschaftlich für die Rechte der Menschen denken und von einer besseren Welt träumen. Einfach erzählen und zuhören.
Erzählen – das ist mein Stichwort: Habe ich Ihnen schon erzählt, dass in diesem Jahr 2025 unglaublich viele Menschen auf die Straße gegangen sind? Demonstrationen in allen Großstädten, aber nicht nur das, auch in Klein- und Kreisstädten fanden Kundgebungen statt. Sie fragen sicher, warum das so ist.
Es ist die Sorge, die die Menschen auf die Straße treibt. Die Sorgen vor aufbrechendem Rechtsextremismus. Die Klimakatastrophe, die Sorgen vor Krieg, die Abschiebeproblematik, gerechtere Löhne und vieles andere mehr kommen auf der Straße zur Sprache. Plakate, Fahnen und wie gesagt sehr viele Menschen sind unterwegs. Und es ist auch Verbundenheit, die demonstriert wird. Verbundenheit auf jeden Fall mit Gruppen, die immer wieder Diskriminierung erleben, so zum Beispiel die LGBTQ-Szene, alle queeren Menschen
Meiner Beobachtung nach sind es die größten Demonstrationen seit der Friedensbewegung in der damaligen DDR, die 1989 zum Mauerfall und der Auflösung der innerdeutschen Grenze, ja zur Wiedervereinigung Deutschlands, führte. Friedliche Demonstrationen waren das. Demonstrationen mit Kerzen und Gesang. Menschen mit viel Mut sahen sich oft genug der damaligen Volkspolizei gegenüber, mit bellenden Hunden, Schlagstöcken und sogar Schusswaffen. Sie haben es damals trotzdem gemeinsam geschafft: Eine Regierung, die immer weiter einlenkte. Die Volkspolizisten, die im richtigen Moment die Nerven behielten. Und die Demonstrierenden mit ihrem Traum von Freiheit. Sie haben es geschafft: Dieses Wunder, dass die Mauer und die Grenze verschwanden. Ich nenne es ein Wunder, weil ich es damals kaum begreifen konnte, als ich im Fernsehen davon hörte. Eine friedliche Demonstration.
Wir brauchen heute friedliche Demonstrationen. Bei uns in Deutschland müssen Demonstrationen angemeldet und bewilligt werden. Sie werden auf bestimmte Plätze oder Straßen verortet und von der Polizei beobachtet. Zunehmend kommt es auch zu Gegendemonstrationen, die ebenfalls genehmigt werden. Sie können sich vorstellen, dass das ein ganz ordentlicher Balanceakt ist. Zunehmend haben wir es auch mit Gewalt zu tun. Bisher konnte aber Schlimmeres verhindert werden.
Ich kenne Menschen, die sagen: Demonstrationen sollten verboten werden. Dem möchte ich ausdrücklich widersprechen. Wir brauchen Demonstrationen. Demonstrationen und Debatten. Wir brauchen es, unsere Meinung auch öffentlich zu äußern und mit anderen zu streiten. Demonstrationen und Debatten sind eine gute Sache. Unsere demokratische Gesellschaft ist auf beides angewiesen. Eleanor, Sie werden in dieser Sache sicher zustimmen. Nur so kann ein gesellschaftlicher Austausch neben den Debatten im Parlament stattfinden. Nur so können wir Minderheiten sehen, zu Wort kommen lassen und uns für sie einsetzen. Und nur so können wir uns auch abgrenzen gegen diejenigen, die unsere Demokratie schwächen und gefährden wollen.
Ich denke viel über Grenzen nach. Grenzen in unseren Köpfen und an den Rändern unseres Landes.
Folgenden Satz habe ich in Berlin an eine Wand gesprüht gesehen: „Ein Kopf voller Grenzen hat keinen Platz für Träume.“
Denken Sie auch, dass wir das Gespräch über Grenzen brauchen, um unseren Träumen näher zu kommen, Eleanor? Wie ging es Ihnen eigentlich, als Sie sich ab 1934 für die Rechte der schwarzen Bevölkerung einsetzten und öffentlich besonders gegen die Rassentrennung demonstrierten? Haben Sie sich manchmal gefürchtet? Wovon haben Sie geträumt? Waren Sie sich immer sicher, das Richtige zu tun? Und war es nicht gut, dass Sie auch als Idealistin – wenn nicht sogar Träumerin unterwegs waren?
In anderen Ländern werden Demonstrationen verboten. Niedergeschlagen. Oft mit brutalem polizeilichem Einsatz. Das erschrickt mich und lässt mich nicht kalt. Es macht mich auch wütend und traurig. Ich trauere um die, die verletzt werden oder sogar zu Tode kommen.
Ich trauere auch um die Missachtung des Art. 20 der Allgemeinen Erklärung der Menschrechte, so wie Sie es 1948 benannt haben:
„Alle Menschen haben das Recht sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.“
Und ich bin dankbar, dass das in Deutschland heute im Jahr 2025 anders ist. Vielleicht sollten wir uns den folgenden Satz zu Herzen nehmen: „Choose your battles wisely!“
Liebe Eleanor, in diesem Sinne herzliche Grüße und danke für Ihre Verbundenheit,
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 21
Jeder Mensch hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter*innen mitzuwirken. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.
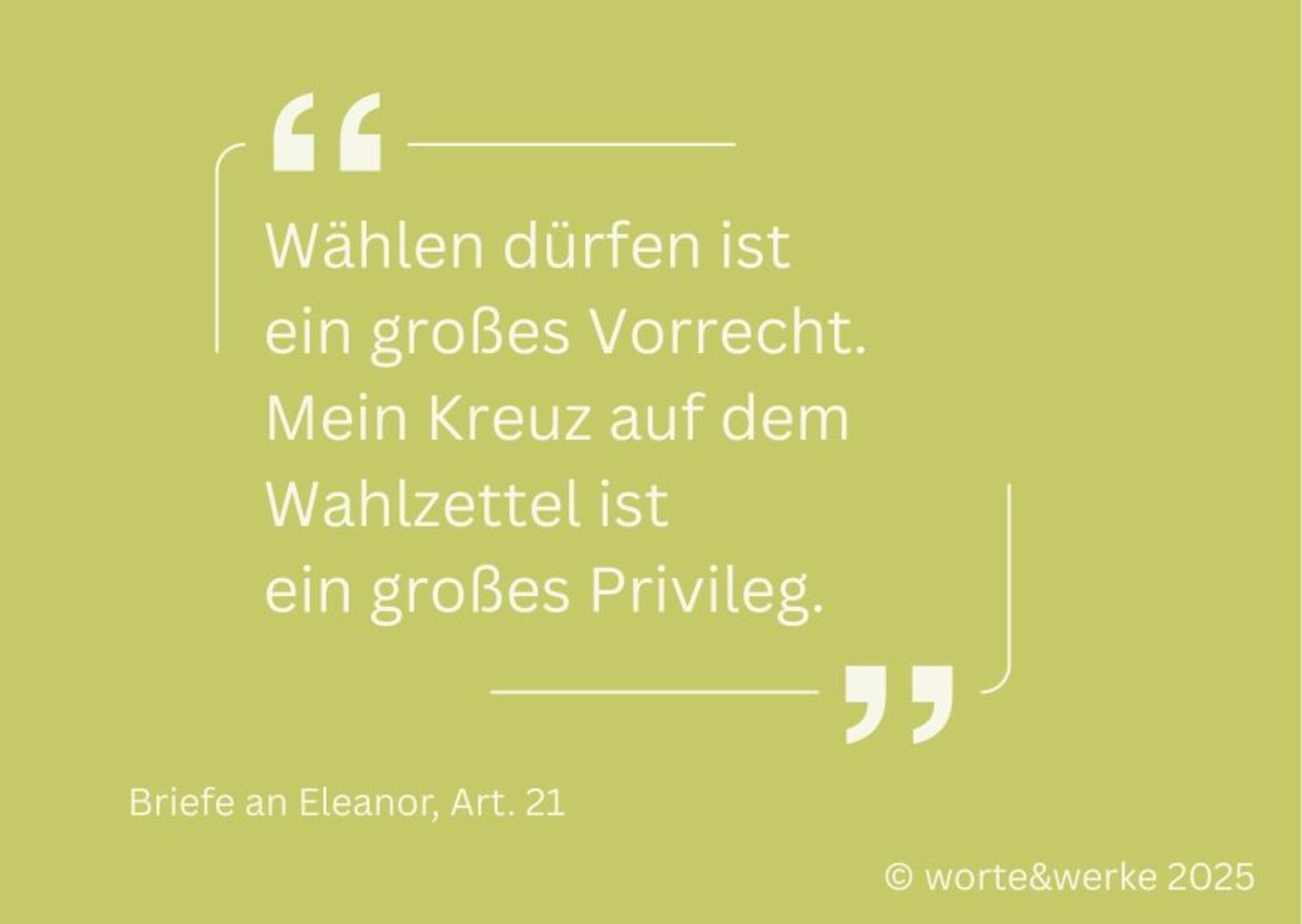
Sittensen, den 25.08.2025
Liebe Eleanor!
Im letzten Jahr besuchte ich mit einer Freundin eine Veranstaltung von „Letters Life“ in der Berliner Philharmonie. An diesem Abend lasen großartige Schauspieler und Schauspielerinnen aus Briefen vor. Nicht aus ihren eigenen, sondern aus Briefen anderer, bekannter oder weniger bekannter, Menschen. Die Namen der Schauspieler*innen werden Ihnen nichts sagen, aber mit Iris Berben, Anke Engelke und Sebastian Koch standen schon sehr beeindruckende Persönlichkeiten auf der Bühne.
Was soll ich sagen? Es war ein wunderbarer Abend – anrührend und erheiternd zugleich. Tränen liefen vor Freude aber auch vor Betroffenheit. Taschentücher wurden gezückt – egal, was gerade vorgelesen wurde. Sie werden sich fragen, warum ich davon berichte, wo ich doch eigentlich über das Wahlrecht mit Ihnen sprechen möchte.
Es wurde unter anderem ein Brief der Suffragetten vorgelesen. Sie wissen die Frauenrechtlerinnen in England, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht kämpften. Manche von ihnen waren sehr einfallsreich. Sie ketteten sich vor dem Buckingham Palace an, warfen Fensterscheiben ein. Eine von ihnen zerstörte sogar 1914 eine Aktmalerei in einem Museum mit sieben Schnitten durch ein Hackbeil. Weil sie diese Art der Darstellung weiblicher Körper nicht ertragen konnte. Aber das allein war nicht der Grund. Sie wissen es, liebe Eleanor. Sie tat es, weil sie gegen die Inhaftierung einer Suffragetten-Schwester protestieren wollte. Daraufhin wurde den Frauen in England allerdings der Besuch von Museen erschwert und teilweise auch gänzlich verwehrt.
An diesem Abend in der Philharmonie wurde ein Brief von einer Suffragette gelesen, die sich über den „Daily Telegraph“ Gehör verschaffte. Es ging um die Frage, wie die Ausschreitungen und Demonstrationen der Suffragetten eingedämmt werden könnten. Sie schlug in ihrem Leserbrief zwei Möglichkeiten vor: „Entweder Sie töten alle Frauen Großbritanniens oder Sie lassen uns wählen.“ So ihre Worte. Nach diesem Brief dauerte es noch weitere fünf Jahre, bis das Wahlrecht in England für Frauen eingeführt wurde. Das galt allerdings bis 1928 lediglich für Frauen, die eine Immobilie besaßen oder mit einem wahlberechtigten Ehemann verheiratet waren und dreißig Jahre alt waren. Unvorstellbar, finden Sie nicht, liebe Mrs. Roosevelt?
In Deutschland können Frauen seit dem 12.November 1918 wählen gehen. Im Blick auf die Chancengleichheit von Männern und Frauen ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte. Ich persönlich denke, dass eine Demokratie nur funktionieren kann, wenn sich möglichst viele Menschen an den Wahlen beteiligen. Männer und Frauen, das bedeutet aber auch, dass alle politische Parteien, die sich zur Wahl aufstellen, das Wohl aller Menschen, die im Land leben, im Blick haben müssen. Sonst gerät etwas in Schieflage. Sie konnten es zu Ihrer Zeit beobachten. Mir geht es im Moment auch so und es bereitet mir Sorgen. Verzeihen Sie, dass ich das so aufrichtig schreibe.
Ich persönlich gehe gerne zur Wahl. Egal ob vor Ort oder per Briefwahl. Wählen zu dürfen, ist ein großes Vorrecht. Meine Stimme abzugeben und mein Kreuz auf dem Wahlzettel leisten zu dürfen, ist ein Privileg. Ich habe diese Möglichkeit noch nie ungenutzt gelassen. Es gibt auch Gruppen in unserem Land, die nicht wählen dürfen: Menschen, die keinen deutschen Pass haben, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren (ab 16 Jahren darf man auf kommunaler Ebene wählen). Und dann gibt es noch diejenigen, die aus rechtlichen Gründen nicht wählen dürfen und denen die Teilnahme an der Wahl durch einen richterlichen Beschluss untersagt wurde.
Liebe Mrs. Roosevelt, ich könnte noch so viel schreiben. Zum Beispiel über die Manipulation von Wahlen in diktatorischen Ländern. Oder darüber, dass es zu ihren Zeiten nicht vorstellbar war, dass eine Frau für das Präsidentenamt in Amerika kandidiert. Bis heute hat es noch keine weibliche Präsidentin gegeben in Ihrem Land. Ich hoffe, dass ich das noch miterleben werde.
Allerdings mache ich mir in diesen Tagen auch etwas Sorgen. Ich schaue mir die derzeitige politische Entwicklung in der Welt an. Es ist so unruhig in der Welt geworden. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich wem glauben soll. Oft würde ich am liebsten weghören. Liebe Mrs. Roosevelt, hoffen wir, dass die Regierenden aller Nationen einen klaren Kopf behalten und sich ihrer Verantwortung für die Menschen im Blick auf das Wahlrecht und viele andere Dinge mehr bewusst sind. Jede Zeit schreibt ihre eigene Geschichte. Stellen Sie sich mal vor, die Suffragetten hätte es nicht gegeben. Ich gehe, davon aus, dass Sie sich dann für das Frauenwahlrecht eingesetzt hätten. Und Sie hätten es geschafft. Dessen bin ich mir sicher. Ich danke Ihnen für Ihren sozial-politischen Einsatz.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 22
Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
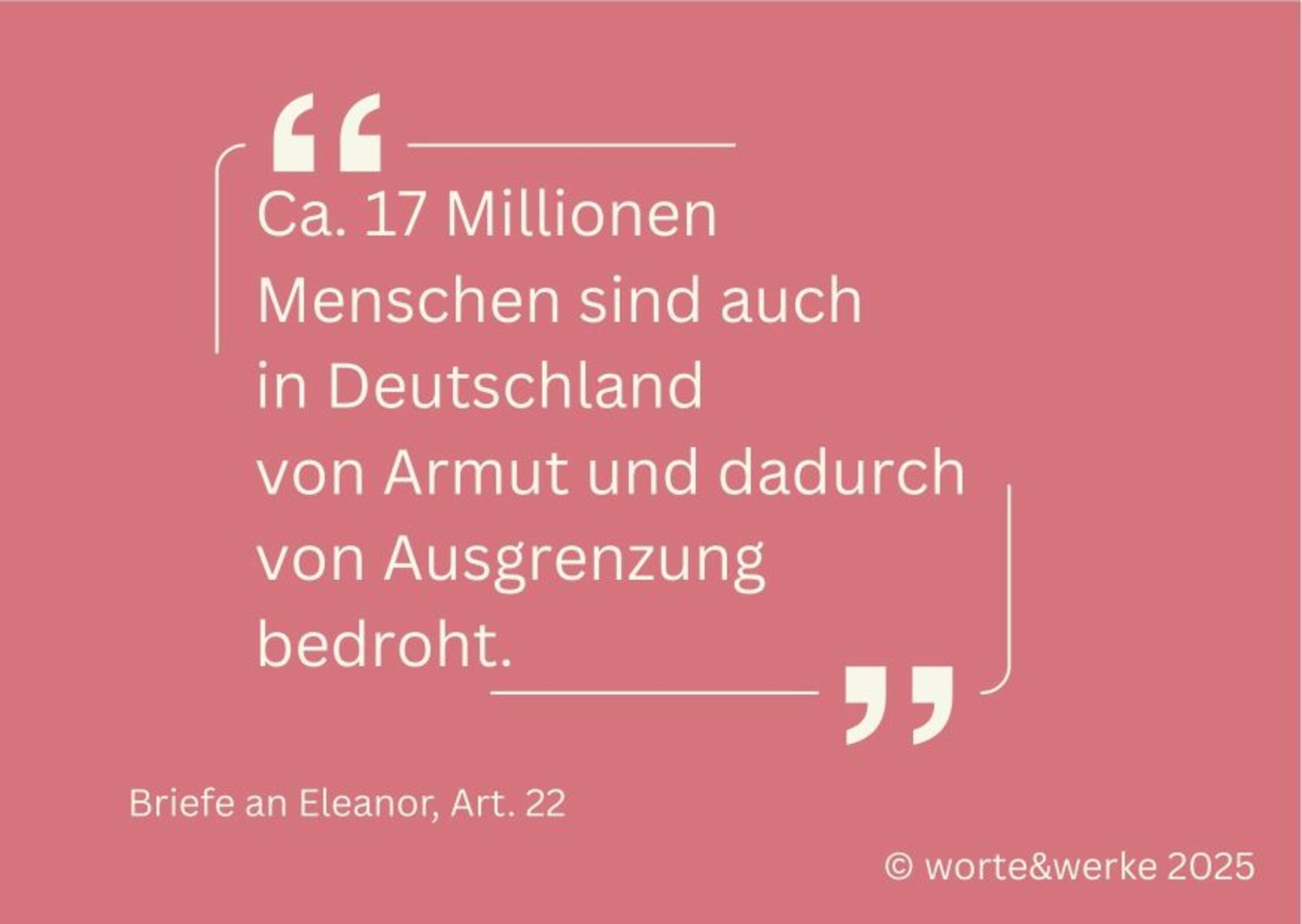
Sittensen, den 26.08.2025
Liebe Eleanor,
verzeihen Sie mir noch einmal diese persönliche Anrede in diesem Brief. An manchen Tagen, wenn ich darüber nachdenke, worüber ich Ihnen als Nächstes schreiben werde, überkommt mich dieses freundschaftliche Gefühl zu Ihnen. Sie waren ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als ich es in meinem Alltag bin und trotzdem gibt es da dieses gemeinsame Suchen nach Lösungen für die Menschen. In meinem und in Ihrem Leben. Das verbindet uns.
War das eigentlich schlimm für Sie, als nicht alle Mitgliedsstaaten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 unterzeichnet haben? Was haben Sie gefühlt? Empörung? Wut? Scham? Darüber musste ich nachdenken. Da war und ist bis heute nicht immer Einigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein großes Ringen um richtige Entscheidungen ist, die Sie und Ihre Kommission durchgemacht haben.
Gerungen und dann aber tatsächlich einstimmig entschieden, wurde 2015 um die AGENDA 2030. Stellen Sie sich vor: Alle 193 Mitgliedsstaaten haben unter dem Leitwort „NIEMANDEN ZURÜCKLASSEN“ diesen Aktionsplan unterschrieben, um gemeinsam wirtschaftliche und soziale Herausforderungen zu bewältigen.
Wie kann das gelingen, dass alle Menschen eine soziale Absicherung bekommen können? Vermutlich hat Sie diese Frage nach den Kriegsjahren auch bewegt. So vieles war zerstört worden und so viele Menschen lagen am Boden. Ohne Hoffnung und ohne eine Aussicht auf ein gutes Leben. Sie selber haben daraufhin gearbeitet, dass soziale Not nicht einfach hingenommen wird, sondern haben als erste Präsidentengattin durch ihre politischen Aktivitäten Neuland betreten und auf soziale Schwachpunkte hinweisen können. Sie kannten auch etwas von bürokratischer Verzögerung von Programmen, die die Schwächsten im Land fördern sollten.
Soziale Sicherheit, das bedeutet für mich doch so viel: Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall oder bei Schwangerschaften, Versorgung bei Armut, im Alter oder bei Arbeitslosigkeit. Ich denke an Wohngeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, an Rente. Die Hälfte unserer Weltbevölkerung profitiert von Systemen wie diesen. Das ist eine gute Zahl.
Diese AGENDA 2030 beeindruckt mich. Zu ihren Zielen gehört zum Beispiel die Sicherung der weltweiten Ernährung. Oder, dass es überall sauberes Wasser geben soll, weniger Ungleichheiten. Globale Partnerschaften sollen beibehalten und gefördert werden. Liebe Eleanor, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie beim Lesen dieser Agenda Ihre große Freude hätten. So viele schöne Aussichten.
Und dann schaue ich Nachrichten und bin erschüttert über das viele Elend in der Welt und frage mich, wie denn diese Ziele bis 2030 umgesetzt werden sollen. Wie kann das alles gelingen, wo doch die Schere zwischen armen und reichen Menschen weltweit und auch in Deutschland immer weiter auseinanderklafft. Ich fühle mich hin- und hergerissen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Es ist wie eine große unüberwindbare Kluft zwischen zwei Felsen. Denn die Realität ist auch diese: Der einen Hälfte der Weltbevölkerung geht es – wie ich Ihnen schon geschrieben habe – gut. Dagegen ist für die andere Hälfte der Weltbevölkerung diese Welt keine schöne Welt, sondern vielmehr ein Ort voller Not und Elend. Es gibt wirklich so viele katastrophale Umstände in denen Menschen leben müssen. Die Zeitungen und sozialen Medien sind voll von schlechten Nachrichten. Und dann schaue ich noch einmal nach Deutschland, rede mit Menschen und stelle fest, wie viele Menschen auch bei uns als Obdachlose unterwegs sind; wie viele Rentner und Kinder an der Armutsgrenze leben. Mir fehlen die Worte. Ich muss schlucken während ich Ihnen das schreibe. Circa 17 Millionen Menschen sind auch in Deutschland von Armut und dadurch auch von sozialer Ausgrenzung bedroht. Liebe Eleanor, das sind über 20 % der Bevölkerung in meinem Land. Dazu gehören Menschen ohne Arbeit, mit geringer Bildung, manchmal Alleinerziehende und Menschen mit geringem Einkommen. Alte Menschen, Kinder. Es braucht zum Beispiel auch bezahlbaren Wohnraum. Verstehen Sie meine große Sorge, dass Menschen mit all dem allein gelassen werden oder aus dieser Armutsspirale nicht herausfinden?
Vor einiger Zeit sagte jemand im Gespräch zu mir: Ja, aber an diesen Menschen haben sich auch schon viele versucht und sind gescheitert. Die wollen auch keine Hilfe.“ Ich gebe zu, ich habe mich sehr über diesen Satz geärgert.
Deshalb möchte ich Ihnen auch von den positiven Entwicklungen erzählen. Seit 1993 gibt es in Deutschland knapp 1000 „Tafeln“. Dahinter verbirgt sich eine große sozial-ökonomische Bewegung, die von vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden getragen wird. Die „Tafeln“ verteilen Lebensmittel an Menschen in Not. Es gibt soziale Kaufhäuser, Kleiderkammern, in denen Menschen für wenig Geld gute, schon getragene Kleidung kaufen können. Es gibt Einrichtungen, die sich um die Betreuung sozial benachteiligter Kinder nach der Schule oder in den Ferien kümmern.
„Genug ist nicht genug“ hat mal jemand gesungen. Die Frage lautet: Reicht das? Ist das wirklich genug? Und wie gehen wir mit der Feststellung um, dass noch viel mehr getan müsste – nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, um in den verbleibenden Jahren den Zielen der Agenda 2030 nachzukommen. Es braucht Hilfe an allen Enden. Menschen sind erschöpft. „NIEMANDEN ZURÜCKLASSEN“ – so lautet die Devise der AGENDA 2030. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen in Ämtern und Einrichtungen daran arbeiten.
Trotzdem sende ich heute hilflose und fragende Grüße an Sie, liebe Eleanor,
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 23
Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.
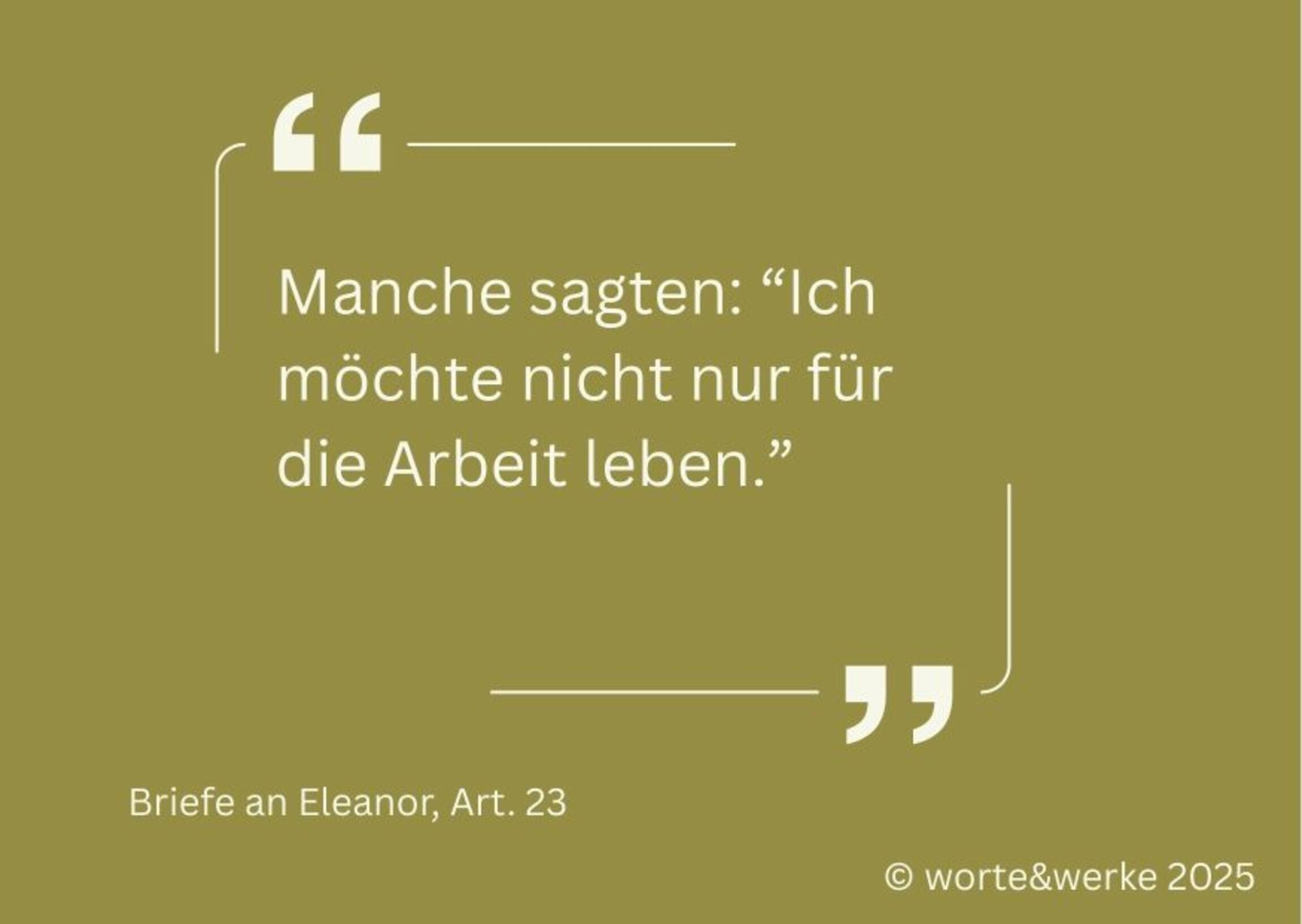
Sittensen, den 29.08.2025
Liebe Eleanor,
während ich Ihnen schreibe, ist gerade Sommer. Viele Menschen fahren in den Urlaub, erholen sich mit ihren Familien oder Freunden und nehmen eine Pause vom Arbeitsalltag. Ich selbst war auch ein paar Tage im Süden Europas, um dem derzeit grauen und verregneten norddeutschen Sommer zu entfliehen.
Urlaubstage nehmen zu können, gehört zu dem Recht, das jedem und jeder zusteht, die einer Arbeit nachgehen. Und trotzdem möchte ich heute mit Ihnen nicht über den Urlaub nachdenken, sondern über die Arbeit.
Sie schreiben „Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit.“
Ich habe viel mit Jugendlichen in der Vergangenheit gearbeitet. Ab und zu sprachen wir darüber, welchen Beruf sie in ihrem späteren Leben erlernen wollten. Einige hatten sehr verrückte Ideen, andere wollten erst einmal reisen und dann studieren. Wieder andere hatten eine handwerkliche Ausbildung im Blick.
Manche sagten: „Ich möchte nicht nur für die Arbeit leben.“ Sie meinten damit, dass sie nicht nur arbeiten und ein bisschen frei haben wollten, sondern dass das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit in einer gewissen Balance stehen sollte. Arbeit sollte auch Spaß machen und einen Sinn haben.
Liebe Eleanor, was hätten Sie den jungen Leuten geantwortet?
Ich versuchte es so: „Dass du arbeitest, ermöglicht dir viele Dinge in deinem Leben. Du kannst dir ein eigenes Leben aufbauen. Unabhängig von deinen Eltern. Deine Wohnung, deinen Unterhalt kannst du bezahlen. Du wirst eine Krankenversicherung bezahlen. Vielleicht hast du ein eigenes Auto. Das bezahlt sich auch nicht von alleine…“ Das waren erst einmal die ganz praktischen Dinge. Dann fügte ich hinzu: „Arbeiten dürfen verbessert deine Lebensqualität. Du kannst nämlich reisen, du kannst dir etwas gönnen. Du könntest auch in deiner Arbeit entdecken, was in dir steckt, welche Begabung und Interessen dich ausmachen. Du könntest dich mit beidem für andere einsetzen.“ Ich freue mich, dass einige von diesen jungen Leuten einen pädagogischen Beruf gewählt haben. Jetzt leisten sie als Lehrer*innen und Erzieher*innen im gesellschaftlichen Bereich ihren Beitrag.
„Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit“, sagen Sie, liebe Eleanor. Wenn ich das lese regt sich in mir Widerspruch. Das geht doch nicht, denke ich. Auf jeden Fall nicht so absolut. Vielleicht haben Sie es auch nicht so ausschließlich gemeint, wie es sich liest. Es gibt kein uneingeschränktes Recht auf Arbeit. Aber Jugendliche dürfen selber überlegen und entscheiden, welchen Beruf sie erlernen möchten. Weder Frauen noch Männer dürfen vom Staat in irgendeine berufliche Richtung gedrängt werden. Das war in der ehemaligen DDR anders: Dort durften aus politischen Gründen nicht alle jungen Menschen studieren. Ich könnte Ihnen jetzt von meinem Klavierlehrer erzählen, aber das führt zu weit.
Liebe Eleanor, es gibt zum Glück ein Recht auf Schutz vor Zwangs- und Kinderarbeit, ein Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt, ein Recht auf sichere Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung, ein Recht darauf, Gewerkschaften gründen zu dürfen. Es gibt auch ein Recht auf Schutz vor Diskriminierung und willkürliche Entlassung am Arbeitsplatz. Für Arbeitslose gibt es das Recht auf soziale Absicherung. Es gibt Arbeitslosengeld um nur ein Beispiel zu nennen.
Ich denke an Ihre Zeit, liebe Eleanor. Zwischen und nach zwei Weltkriegen. Wie wichtig war da die Feststellung, dass soziale Sicherheit und Gerechtigkeit Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden sind. Sie haben 1927 mit einigen Damen eine Fabrik gegründet. Diese Fabrik stand in der Nähe eines Tals, in dem die Menschen ausschließlich von der Landwirtschaft lebten. Sie boten den Bauern an, in Monaten in denen auf den Feldern die Arbeit ruhte, in dieser Fabrik zu arbeiten. Durch industrielle Arbeit sollten sie ein dauerhaftes Zusatzeinkommen haben. Ich staune. Was für eine Idee, liebe Eleanor. Wie geschickt Sie diese Sache verhandelt haben: Mit einer gehörigen Portion Naivität, aber auch Frechheit. „Chapeau!!“ sage ich.
Und wie oft sind Sie aufgestanden gegen Diskriminierung und missbräuchliche Arbeit?! Ich danke Ihnen. Damit sind wir beim nächsten Thema, das mich beschäftigt: Viele Kleidungsstücke, Schuhe und auch Lebensmittel, wie Tee, Kakao, Kaffee, um nur einige zu nennen, können wir in Deutschland nur so günstig kaufen, weil am anderen Ende der Lieferkette nachweislich Kinder und Erwachsene ausgebeutet werden und unter menschenunwürdigen Bedingungen für unseren Wohlstand arbeiten müssen. Sollten wir nicht genauer hinschauen?
Vielleicht hilft die Frage: Wo wird meine Kleidung hergestellt? Woher kommt mein Frühstückskaffee? Da wünsche ich mir mehr Konsequenz im Handeln. Auch bei mir selbst.
Und noch eine weitere Frage beschäftigt mich: Wenn jemand den Arbeitsplatz verliert oder keine Arbeit mehr findet, wenn jemand unvermittelbar ist, dann befindet er/sie sich in einer finanziellen und sozialen Abwärtsspirale. So geht es einigen Menschen ohne feste Beschäftigung. Natürlich gibt es staatliche Unterstützung – das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen und das ist sehr wichtig. Aber der Unterschied in der Gesellschaft zwischen denen, die arbeiten und Geld verdienen, und denen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, wird immer größer. Dazu kommt die Frage nach all der unbezahlten Care-Arbeit, die Mütter oder Väter leisten, während sie auf eine bezahlbare Arbeit zugunsten der Kinder verzichten.
Kulturelles erleben, wie Theater, Konzerte, ist ohne festen Arbeitsplatz nicht möglich. Wohnraum nicht mehr bezahlbar. Ich habe beobachtet, wie Menschen aus dem Gesellschaftssystem gefallen sind, nachdem sie Jahre in der Arbeitslosigkeit verbracht haben. Ehrlich gesagt, stand ich hilflos daneben und wusste gar nicht, was ich tun kann.
Ich frage mich, was Sie heute tun würden. Welche Anregungen könnten Sie einem Land wie Deutschland geben? Einem Land, das sicher viel im Blick auf das Recht auf Arbeit tut und es trotz alledem nicht für alle reicht.
Sie sehen mich fragend an diesem Tag.
Einen freundlichen Gruß aus der Sommerpause
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 24
Jeder Mensch hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.
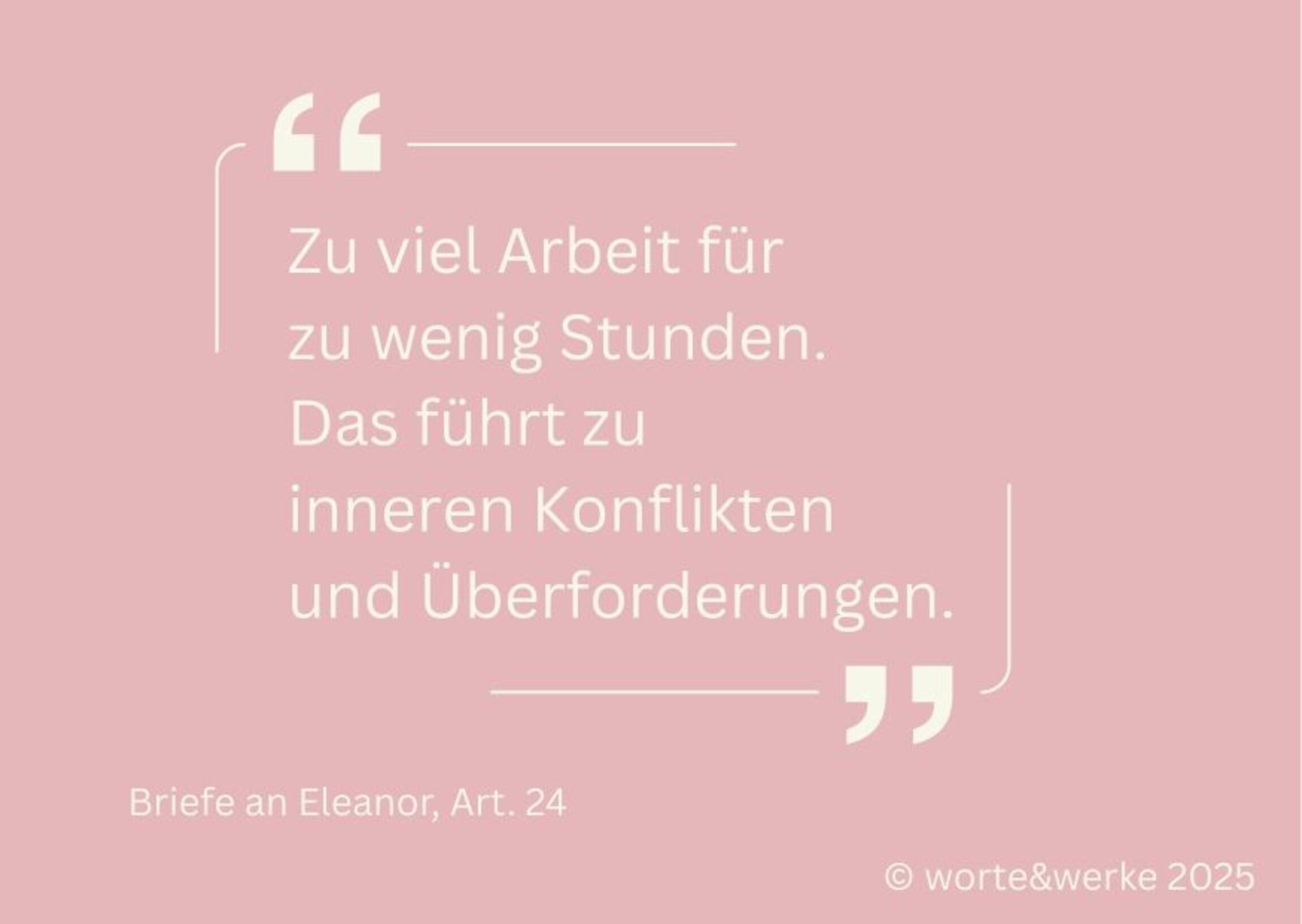
Sittensen, den 30.08.2025
Liebe Eleanor,
ich kenne Menschen, die die Arbeit krank gemacht hat.
Es war nicht das Arbeitsumfeld, also die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Es war auch nicht die Frage nach dem Gehalt. Das war in den meisten Fällen angemessen. Menschen erkrankten in ihrer Arbeit, weil schlicht und ergreifend die Menge der Arbeit, die in einem bestimmten Zeitfenster durchgeführt werden sollte, zu viel war. Zu viel Arbeit für zu wenige Stunden. Das führte zu inneren Konflikten und Überforderungen. Diese Überforderungen äußerten sich in Stresssymptomen und ließen engagierte und sehr geschätzte Leute zusammenbrechen. „Burn-out“ lautete die Diagnose. Sie waren „ausgebrannt“ von der Arbeit.
Seit 1994 gilt in Deutschland eine geregelte Arbeitszeit von durchschnittlich 8 Stunden pro Tag. Es gibt allerdings immer noch Berufe, die in 24 Stunden Schichten arbeiten - zum Beispiel im Krankenhaus, Ärzte Ärztin, Krankenschwester, Krankenpfleger und Berufe, die laut Vertrag rund um die Uhr eine Präsenzpflicht haben.
Im Laufe der Jahre wurden die Arbeitszeiten schrittweise reduziert und angeglichen. Im Moment arbeiten Menschen im öffentlichen Dienst 38,75 Stunden in der Woche. Menschen mit selbstständigem Unternehmen verfügen ohne Einschränkungen von außen über ihre Zeit und sind in dieser Beziehung auch für sich selbst verantwortlich.
Es gibt Ganztags- und Halbtagsjobs, Nebenjobs. Es gibt kurzfristige Beschäftigte und andere Beschäftigungsmodelle. Und mit jedem Arbeitsvertrag wird die Zahl der Arbeitsstunden vereinbart. Nichtsdestotrotz geschieht es, dass die Arbeit Menschen über den Kopf wächst, wir nennen es „Burn-out“.
„Work-Life-Balance“ ist heute zu einem wichtigen Faktor geworden. Die „Work-Life-Balance“ muss stimmen. Neben der Arbeit muss genügend Zeit für einen gesunden Freizeitausgleich sein. Die Arbeit darf nicht der wichtigste Punkt im Leben sein, damit ein Mensch nicht körperlich oder psychisch erkrankt.
Ich bin sehr froh, dass Menschen vor meiner Zeit für die Begrenzung der Arbeitszeit gekämpft haben. Sicher haben Sie, liebe Eleanor auch von Robert Owen gehört. Ein britischer Unternehmer, der im 18./ 19. Jahrhundert lebte. Von ihm wird berichtet, dass er den 24-Stunden-Tag schon damals in drei Zeitabschnitte einteilte: „8 Stunden Arbeit - 8 Stunden Freizeit - 8 Stunden Schlaf“.
Dafür setze er sich ein und seine Angestellten waren ihm sehr dankbar.
Liebe Eleanor, bei all den Aufzählung will ich nicht unterlassen, Ihnen von unserem derzeitigen Problem im Blick auf die Arbeitszeitbegrenzung zu schreiben.
Wir stecken nämlich in einer Wirtschaftskrise. Es gibt derzeit einen sogenannten „Fachkräfte-Mangel“. Unser Bruttoinlandsprodukt ist gesunken. Geschäfte schließen. Die „fetten“ Jahre sind wohl vorbei und ein großer Teil der Bevölkerung stellt am Ende des Monats fest, dass weniger Geld im Portemonnaie oder auf dem Konto ist als früher. Lebensmittel werden schon seit einigen Jahren immer teurer. Wir schaffen unter den gegebenen Rahmenbedingungen unsere Arbeit nicht mehr. Es gibt Bestrebungen von der Politik, die sagen, dass im Laufe eines Jahres mehr Stunden gearbeitet werden sollen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, liebe Eleanor, aber ich ahne, wie dieses Thema unsere Gesellschaft wieder einmal in verschiedene Lager spalten wird. Es macht mich nachdenklich, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrieländern relativ wenig arbeiten (im Blick auf die Arbeitsstunden).
Wie kann das also zusammen gehen? Die Arbeit, die getan werden soll und die Belastungsgrenze von Menschen? Wie fein und vorsichtig – auch im Blick auf das Menschenrecht auf Begrenzung von Arbeitszeit – muss an dieser Stelle justiert werden. Wo gibt es Grenzen der Belastbarkeit?
Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um die junge Generation. Unsere Bevölkerung altert, liebe Eleanor. Uns beschäftigt die Frage der „Generationengerechtigkeit“. Welche Entscheidungen sollten wir heute zum Beispiel im Blick auf die Sicherung des Lebensstandards treffen, so dass nachfolgende Generationen nicht unter den Belastungen zerbrechen, die meine Generation ihnen aufbürdet? Ich hoffe es gibt Menschen in der Regierung und in der Wirtschaft mit guten innovativen Ideen zu diesem Thema. „Burn-out“ ist eine schlimme Erkrankung. Narben bleiben auf der Seele der Betroffenen.
Als Christin, Mutter und Großmutter bete ich für die jungen Menschen, die ihr Arbeitsleben noch vor sich haben. Ich bete für genügend Pausen und Freude an der Arbeit, für Stabilität und Gesundheit. Ich bete für Menschen, die mutig aufstehen und dafür einstehen, wenn unsere Gesellschaft in Schieflage gerät. Ich bete, dass sie mit ihrem Anliegen gehört werden. Haben Sie eigentlich auch gebetet, wenn es schwierig wurde?
In herzlicher Verbundenheit
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 25
Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.
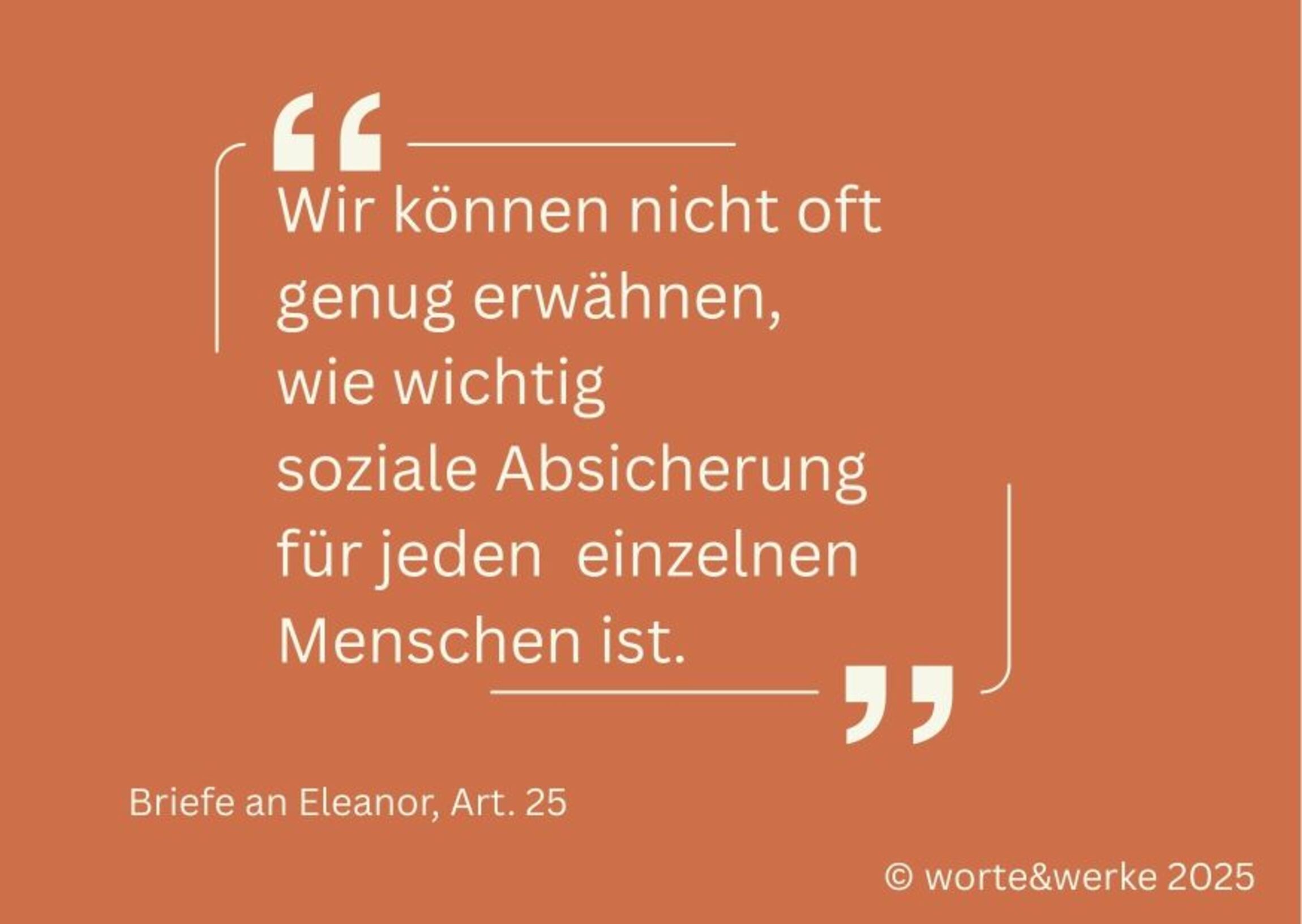
Sittensen, den 01.09.2025
Liebe Eleanor,
vielleicht hört sich das Folgende, das ich Ihnen schreiben werde, wie eine Wiederholung der vorhergegangenen Briefe an. „Ein Schelm, der Böses dabei denkt“, sage ich und schreibe Ihnen heute diesen Brief zum Art. 25 der Menschenrechtserklärung.
Sie werden mit mir einer Meinung sein, wenn ich sage: Im Grunde können wir doch nicht oft genug erwähnen, wie wichtig soziale Absicherung für jeden einzelnen Menschen ist. Es sei denn, jemand kann es sich finanziell leisten, lebt autark und schert sich nicht um das Wohlergehen seiner/ihrer Mitmenschen.
In den großen Städten gehen die Menschen auf die Straßen. Ich schrieb Ihnen schon davon. Sie demonstrieren für bezahlbaren Wohnraum – soll heißen: für niedrigere Mieten. Ich weiß nicht, wie das Problem zu lösen ist, liebe Eleanor, aber ich finde es gut, dass diese Art der Meinungsäußerung in unserem Land möglich ist. Natürlich gibt es auch diejenigen, die mit allen möglichen Argumenten auftreten, um solche Demonstrationen für überflüssig zu erklären und zu verhindern. Was denken Sie darüber?
Ich habe Sie als eine Frau kennengelernt, die sich auch für dieses Anliegen eingesetzt hätte. Sie haben doch so oft in Ihrem Leben zu gerechterem Handeln aufgefordert. Sie selbst haben doch mit ihrem Engagement gerechtes Handeln ermöglicht. Und Sie haben sich nicht dazu verleiten lassen, nur das ungerechte Handeln anderer an den Pranger zu stellen und anzuklagen. Nein, Sie haben gehandelt. Vielleicht ist „Hingabe“ das richtige Wort für ihren Einsatz. Sie waren wirklich voller Hingabe für die Menschen ihrer Zeit unterwegs. Woher nahmen Sie diese Entschlossenheit?
Ich habe zum wiederholten Mal den Eindruck, dass ich sehr viel von Ihnen lernen könnte. Von Ihrem Blick auf gerechtere Umstände, unter denen Menschen leben können.
„Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl gewährleistet.“ So lautet eine Kurzfassung, die von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zum Menschenrecht Art. 25 formuliert wurde. Sie haben ja sehr detailliert beschrieben, was dieses Menschenrecht umfassen soll. Fast macht es auf mich den Eindruck, dass Sie nichts – aber auch gar nichts – in Ihrer Formulierung übersehen wollten. Ich schreibe es mit meinen eigenen Worten. (Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe.) Alle Menschen sollen sich im Blick auf ärztliche Versorgung, Kleidung, Ernährung, soziale Leistung sicher fühlen. Für jeden soll es reichen. Niemand soll übersehen werden. Jeder Mensch soll in seiner Lebenssituation gesehen werden. Ich finde das sehr beeindruckend.
Allerdings merke ich im Blick auf gegenwärtige Entwicklungen auch, wie schwer die Umsetzung ist. Die Frage: „Was ist wirklich gerecht?“, beschäftigt mich. Ich kenne sehr unzufriedene Zeitgenossen und ich kenne auch in gutem Sinne fragende Zeitgenossen. Ich kenne dazu auch Leute, die immer über ihre Verhältnisse leben. Irgendwann wird dann klar, dass es so nicht weitergehen und nicht gut gehen wird.
Natürlich können Sie, liebe Eleanor, mir an dieser Stelle vorhalten, dass ich mit meiner Lebenssituation sehr privilegiert bin. Da gebe ich Ihnen auch recht. Aber meine Frage lautet: „Ist die Gewährleistung all dieser Dinge in jedem Moment wirklich umsetzbar?“
Sie schreiben von „unverschuldeten Umständen“. Es gibt schlimme und bewegende Schicksale einzelner Menschen und Familien. Plötzlich stehen sie vor dem Nichts. Ich denke gerade an eine Familie, deren Haus in einer Nacht abgebrannt ist oder an Verkehrsunfälle mit unvorhersehbaren finanziellen Folgen für die Betroffenen. Soziale Sicherheit in „unverschuldeten Umständen“… Vielleicht wäre ein kleiner Weg auch die Vereinfachung von Formalitäten im Blick auf die Unterstützung derer, die Hilfe brauchen.
Ein letztes Wort, das mich in Ihrer Formulierung bewegt, ist das Wort „Fürsorge“. Aus meinem christlichen Kontext heraus könnte ich auch sagen „Barmherzigkeit“. Das bedeutet doch nichts anderes, als diejenigen zu sehen, die Hilfe brauchen und ihnen diese Hilfe gewähren und zukommen zu lassen. Hungernden Nahrung geben, Durstigen etwas zu trinken, Fremde „Willkommen“ heißen, Kranke versorgen, Gefangene besuchen. (Anmerkung: Es gibt auch die, die in sich selbst, in ihren Gedanken und Lebensumständen gefangen sind.) Auf die achten, die ihre Sprache verloren oder keine eigene Stimme mehr haben. Die Liste der Möglichkeiten für Engagement und Verantwortung könnte noch weiter ausgeführt werden. Ich belasse es für heute dabei.
Aber einen Gedanken, liebe Eleanor, möchte ich noch mit Ihnen teilen: Ich habe ein Buch gelesen, welches den Titel trägt: „Islam bedeutet Barmherzigkeit“. Sollten nicht alle Religionen für Barmherzigkeit und für Sicherheit einstehen. Würden sie damit nicht eine große gesellschaftliche Stütze innerhalb eines Staates werden?
Ich wünschte Sie, liebe Eleanor, würden mir heute antworten. Und ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft, dass wir - die Menschen- es schaffen, benachteiligte Menschen zu sehen und Verantwortung für sie zu übernehmen.
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 26
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.
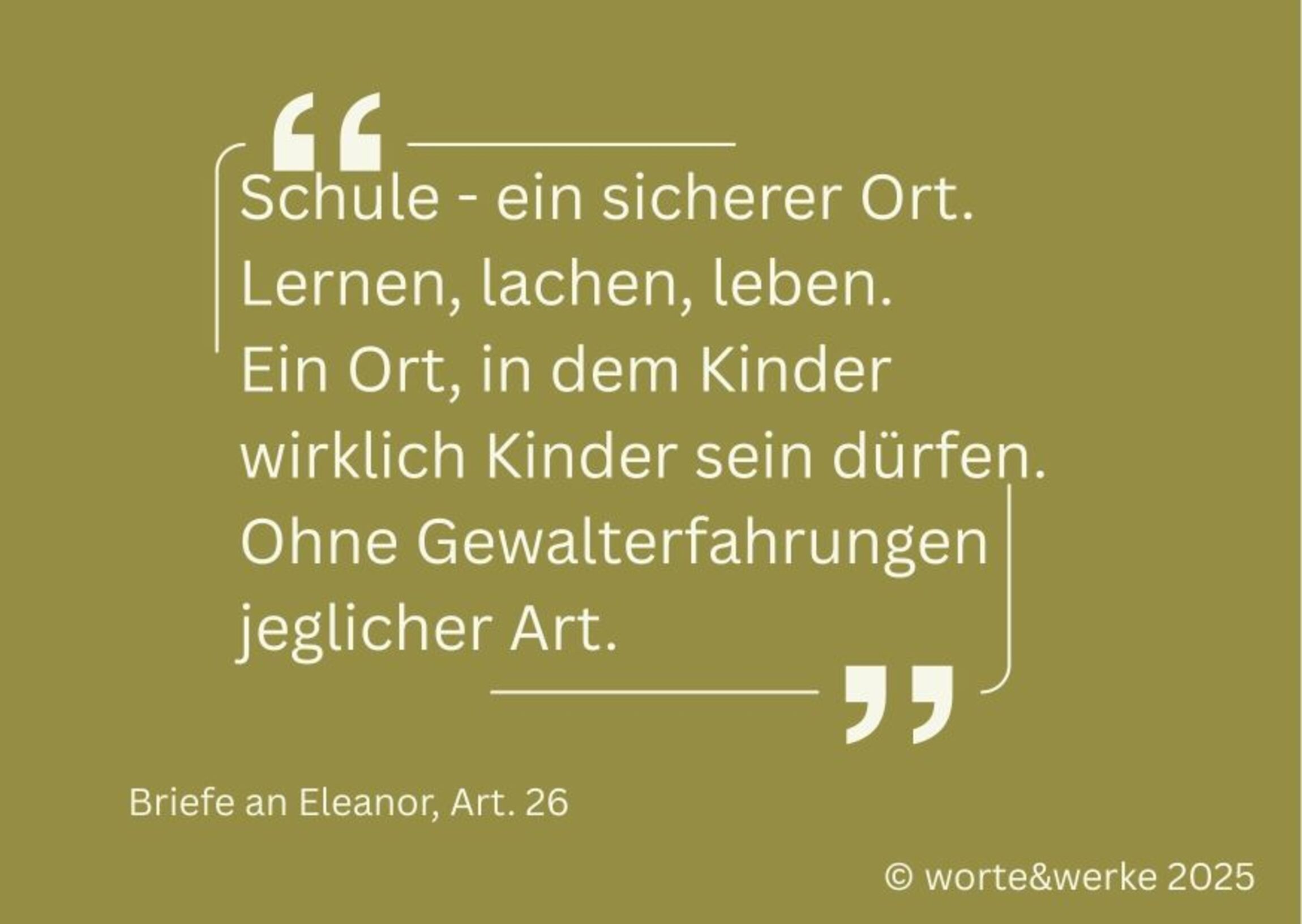
Sittensen, den 04.09.2025
Liebe Eleanor,
seit einiger Tagen sind bei uns die Sommerferien zu Ende. Die Kinder gehen wieder in die Schule. Jungen und Mädchen der ersten Klasse tragen auf ihrem Rücken stolz zum ersten Mal den Schulschulranzen zur Grundschule in unserem Dorf. Vor ihnen liegen einige Jahre, in denen sie die Schule lieben oder nicht lieben werden. Sie werden den unterschiedlichsten Lehrkräften begegnen. Sie werden sich mit Themen auseinandersetzen, die sie interessant finden oder auch nicht.
Die neuen Schulkinder werden sich auch mit neuen Kindern auseinandersetzen müssen. Manche von ihnen sind nicht in Deutschland geboren. Sie werden lernen, wie Konflikte gelöst werden können. Manchmal werden sie an ihre Grenzen kommen.
Sie werden Zeugnisse über ihre Leistungen erhalten. Sie werden sich in der Bewertung gerecht oder ungerecht behandelt fühlen. Sie werden in Klassenräumen sitzen und manchmal auch mit ihrem Klassenverband Feste feiern. Sie werden später durch die Schule hoffentlich in der Lage sein, einen Beruf zu erlernen, der ihren Fähigkeiten entspricht.
Damit das gelingen kann, trägt der Staat –genauso wie die Eltern – eine große Verantwortung. Durch die Anerkennung des Menschenrechts auf Bildung hat sich Deutschland verpflichtet, folgende Ziele der Vereinten Nationen zu unterstützen: Bildung sollte für jedes Kind verfügbar, zugänglich, geeignet und anpassbar sein. In diesen vier Worten verbergen sich große Gedanken, die es in die Tat umzusetzen gilt, und auch Fragen, die zu beantworten sind:
Jedes Kind, egal, welchen Geschlechts, soll zur Schule gehen. Es soll Zugang zu guten Arbeitsmaterialien haben. Dazu sollen Schulen, sowohl von den baulichen Gegebenheiten als auch vom Unterrichtsangebot, für Kinder mit Behinderung zugänglich sein. Inklusion ist ein weiteres wichtiges Stichwort. Im Unterricht sollen Kinder die Chance bekommen, ihre eigenen Talente zu entdecken und zu entwickeln.
Schulbücher und Unterrichtsformen sollen der gesellschaftlichen Transformation entsprechend angepasst werden, denn guter Unterricht ist eine Grundvoraussetzung für Lernerfolge.
Liebe Eleanor, das ist nur eine kleine Auswahl einer großen Liste.
Bildung war Ihnen persönlich immer ein wichtiges Anliegen. 1927 haben Sie eine Mädchenschule in New York City geleitet. Mädchen sollten an dieser Schule in ihren sozialen und intellektuellen Fähigkeiten gefördert werden. Ihr Ehemann Franklin, setze sich ab 1935 ebenso für die Ausbildung junger Menschen in Schulen und Colleges ein. Circa 300.000 junge Leute bekamen daraufhin finanzielle Unterstützung für ihr Studium. Sie wussten es beide: Gute Bildung ist wichtig.
Es ist doch so: Gute Bildung ist die Voraussetzung für gute Kommunikation und für respektvolles Miteinander in einer Gesellschaft. Durch gute Kommunikation kann auf der Basis der geltenden Rechte das Zusammenleben in einem Land gelingen und darüber hinaus auch mit anderen Ländern.
Sie, Eleanor, fühlten sich immer der Emanzipation von Frauen verpflichtet. Es würde Sie traurig machen zu hören, dass heute besonders Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt wird. So ist es zum Beispiel in Afghanistan. Ich durfte den Brief einer jungen Frau lesen, die mittlerweile in den USA studiert hat. Sie bedankte sich in diesem Brief bei ihrer Mutter. Ihre Mutter hatte sie zur Flucht aus Afghanistan ermutigt, damit sie als junge Frau bessere Bildungschancen wahrnehmen konnte. Eine Mutter ermutigte ihre Tochter, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie können sich vorstellen, dass das ein bewegender Brief voller Heimweh und dann auch wieder Dankbarkeit war.
Ein letzter Gedanke noch, liebe Eleanor: In unseren Grundschulen lernen Kinder vor allem lesen, schreiben, rechnen. Welche Folgen es haben kann, wenn Menschen all das nicht lernen können, sehen wir in Ländern, in denen Großteile der Bevölkerung keinen Zugang zu Bildung erhalten. Die UNESCO benennt die geschätzte Zahl von ca. 750 Millionen jungen und erwachsenen Analphabeten weltweit. Wie wird ihre Zukunft aussehen, wenn sich im Blick darauf nichts ändert? Werden sie in dieser Welt nicht immer zu den Benachteiligten gehören?
Was würden Sie uns heute raten? Wo würden Sie ansetzen, um Hilfe gegen den Analphabetismus zu ermöglichen?
Schule sollte ein Ort des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Anerkennung sein und bleiben. Junge Menschen sollten lernen, Diskriminierung zu erkennen und zu unterlassen. Darüber hinaus sollten sie lernen, dass sie selbst eine Würde als Menschen haben, und dass sie jeden einzelnen Menschen genau wegen dieser Würde achten müssen. Schüler*innen sollten in der Schule lernen, die Rechte und Pflichten unserer demokratischen Rechtsordnung zu verstehen und zu schätzen. In der Schule sollte gelernt, gelacht und gelebt werden. Ein sicherer Ort, in dem Kinder wirklich Kinder sein dürfen. Ohne Gewalterfahrungen jeglicher Art. Kinder sollten lernen die Umwelt zu achten und zu schützen. Schulen sollten Kinder darauf vorbereiten, dass sie später selbstbewusst Verantwortung für ihre Gesellschaft tragen dürfen. Die Kinder sollten lernen, ihre eigene Sprache und Kultur zu schätzen und sie im Austausch mit Menschen aus anderen Ländern als Bereicherung zu verstehen.
Mein Dank gilt den vielen Sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen, die sich sehr für die Schule als „gutem Bildungsraum“ engagieren und sehr gute Arbeit leisten.
Es gibt soviel zu tun und zu denken im Bereich auf die Bildung.
Hoffen wir, dass der Lehrkräftemangel in unserem Land nie aus dem Blick gerät.
Und dass die demokratischen Grundrechte unangefochten bleiben.
Danke, dass Sie sich dafür eingesetzt haben.
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 27
Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
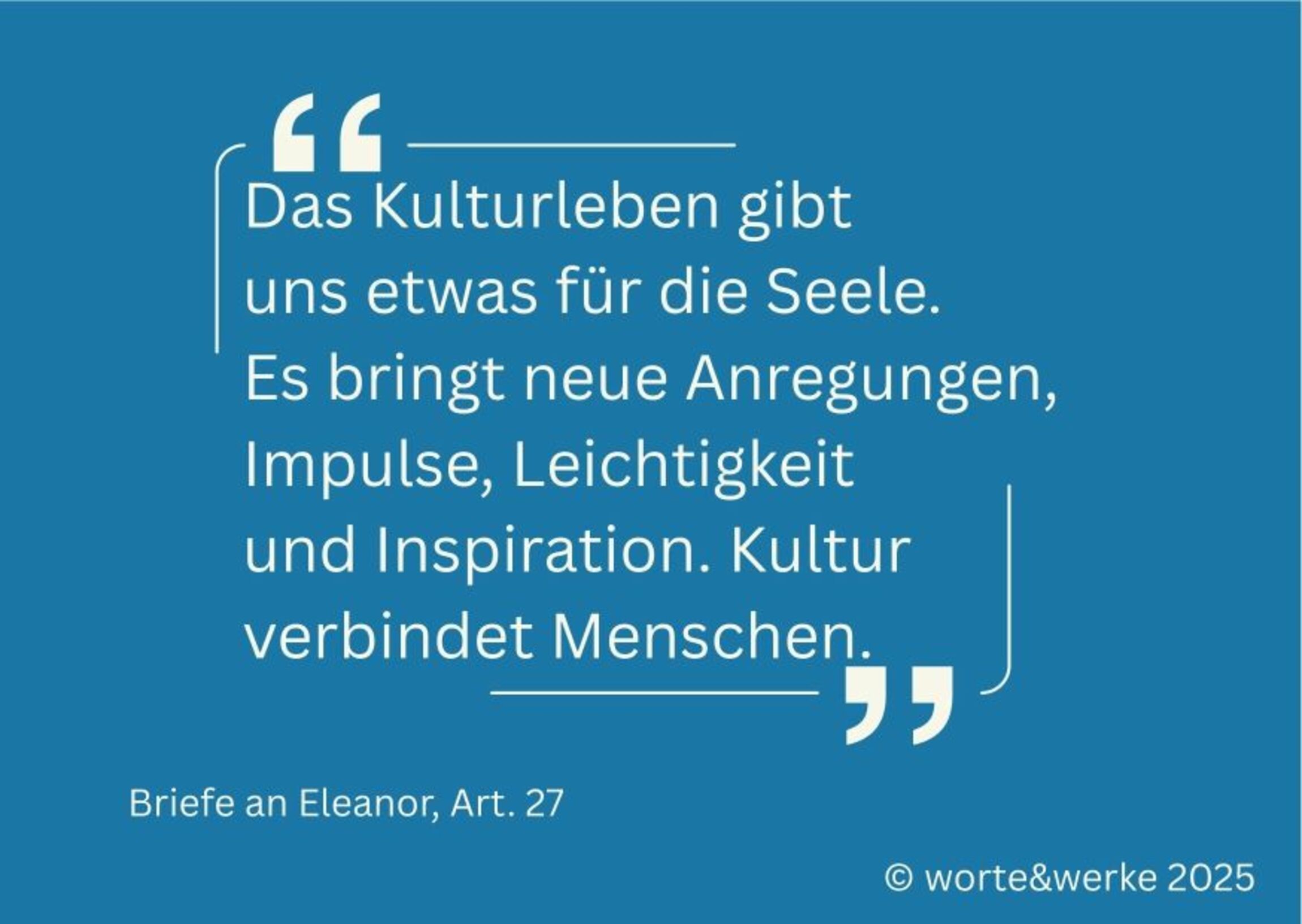
Sittensen, den 07.09.2025
Liebe Eleanor,
im März 2020 war ich für ein paar Tage auf der ostfriesischen Insel Norderney. Ich hörte keine Nachrichten. Ich las keine Zeitung. Als ich am 13. März wieder bei meiner Familie eintraf, stand fest, dass eine Epidemie ausgebrochen war. Von China aus verteilte sich das sogenannte Corona-Virus über die ganze Welt. Erschreckende Bilder wurden aus Italien gesendet. Viel zu viele Menschen bekamen Erkältungssymptome und starben in kürzester Zeit. Ich erinnere mich an die schrecklichen Bilder im Fernsehen, an überforderte Menschen und Gesundheitssysteme.
Es wurde eine Maskenpflicht für alle eingeführt. Begegnungen zwischen Menschen fanden möglichst nur noch zwischen zwei Personen und im Freien statt. Man kann von Glück sagen, dass die technischen Entwicklungen so weit fortgeschritten sind, dass wir uns in digitalen Räumen zu Meetings, Konferenzen oder Spielabenden treffen konnten. Denn alles wurde dicht gemacht. Schulen wurden geschlossen. Geschäfte durften nicht öffnen. Besuche bei Behörden und Ämtern wurden auf digitale Vorgänge umgestellt. Alles wurde abgesagt: Konzerte, Vorträge, Lesungen, Chöre, Sportgruppen, Sport-Events, Gottesdienste, Konzerte, Museen, Ausstellungen und vieles andere, das ich hier gar nicht alles erwähnen kann.
Im September 2020 sprach man von circa 1 Million Menschen, die in kürzester Zeit an Corona gestorben waren.
Diese Zeit hat bis heute ihre Spuren hinterlassen. Ich möchte ihnen vor allem von den Kunstschaffenden in unserem Land erzählen. Musiker*innen, Autor*innen, Schauspieler*innen, Artist*innen, Tänzer*innen und alle, die in dem künstlerischen Bereich arbeiten, erlitten neben großen finanziellen Einbußen, auch Nöte im Blick auf ihre Wirksamkeit. Sucht eine Schauspielerin doch die Bühne und ein Musiker sein Publikum. Und betrachtet man es von der anderen Seite, verhält es sich ähnlich:
Das Kulturleben gibt uns etwas für die Seele. Es bringt neue Anregungen und Impulse, Leichtigkeit und Inspiration. Kultur verbindet Menschen.
Liebe Eleanor, ich denke an wunderbare Theateraufführungen, Filme, Chor-Events, große Konzerte, die jeder und jede besuchen kann. Sie selbst haben großen Wert darauf gelegt, Kultur, Künstlerinnen und Künstler entsprechend zu fördern und zu honorieren. Sie riefen zahlreiche Kulturprojekte ins Leben, die für andere zur Inspiration wurden, oder den Menschen Freude bereiteten. Ich denke, dass sie es nicht versäumten, in New York City, oder auch als First Lady, zahlreiche Konzerte und Aufführungen zu besuchen.
Sicher wüssten auch heutige Künstler und Künstlerinnen Ihre Kritiken zu schätzen. Wie gerne würde ich Ihnen heute die „Elphi“ in Hamburg zeigen. Sie würden begeistert sein. Da bin ich mir sicher. Außer sonntags schrieben Sie in den Jahren von 1935-1962 täglich eine kleine Kolumne unter dem Titel „MY DAY“, die in den 1950er Jahren von neunzig Zeitungen in Amerika veröffentlicht wurde. Wie haben Sie das neben Ihren anderen Verpflichtungen nur geschafft? Welche Möglichkeiten gab Ihnen diese Tätigkeit? Sie konnten zu aktuellen Ereignissen Stellung nehmen, besonders im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie äußerten sich in anderen Zeiten zur Frauenbewegung und dem Bürgerrecht. Ihre Leserschaft konnte sich ihres Eifers glücklich schätzen. Ich habe einige ihrer Kolumnen gelesen und bin sehr beeindruckt von ihrer Begeisterung für so vieles, über das Sie schreiben und von Ihrem Fleiß. Ich glaube, Sie und ich und viele andere sind sich einig in der Feststellung, dass Kunst jeder Art die Menschen zusammenbringt. Darauf möchte ich nicht verzichten. Das habe ich mir vor zwei Jahren vorgenommen. Seitdem besuche ich jeden Monat ein kulturelles Ereignis.
Aber Kultur kostet Geld. Die Kommunen oder den Staat, aber auch die Besuchenden. Je nachdem, was sich jemand aussucht, kann es auch sehr teuer werden.
Zum Glück gibt es mittlerweile Projekte, in denen Besucher für andere mitbezahlen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Kinder, Schüler*innen, Studierende, Senior*innen sowie Menschen mit Behinderungen bekommen ermäßigte Preise.
Jeder und jede hat das Recht an künstlerischen Veranstaltungen teilzunehmen. Niemand hat das Recht jemanden auszuschließen. Sie erinnern sich, dass das nicht immer so war.
Kunst könnte ohne finanzielle Förderung eventuell gar nicht existieren. Förderungen könnten aufgrund von Sparmaßnahmen zurückgehen. Vor ein paar Wochen wurde ich unverhofft Zeugin im Osten Deutschlands bei einem Gespräch, das sich um die Schließung eines Theaters drehte. Dort stand in Aussicht, dass die bisherigen Fördergelder zur Finanzierung des Hauses gestrichen werden sollten. Kulturschaffenden bereitet dieser Gedanke zunehmend Sorgen.
Aber: Die Kultur geht jetzt aufs Land und die Landbevölkerung fährt zur Kulturveranstaltung in die Stadt. Es ist Bewegung in der Szene. Es gibt auch bei uns auf dem Dorf Laienschauspielgruppen, die andere mit ihren Theaterstücken begeistern. Es gibt Kirchenmusik, Blasorchester, Posaunenchöre, Tanzgruppen und Festivals auf dem Land.
„Jeder hat das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben.“ Art. 27
Ich danke Ihnen heute, liebe Eleanor, besonders für das Aufnehmen dieses Rechts in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Es tut uns gut.
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 28
Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.
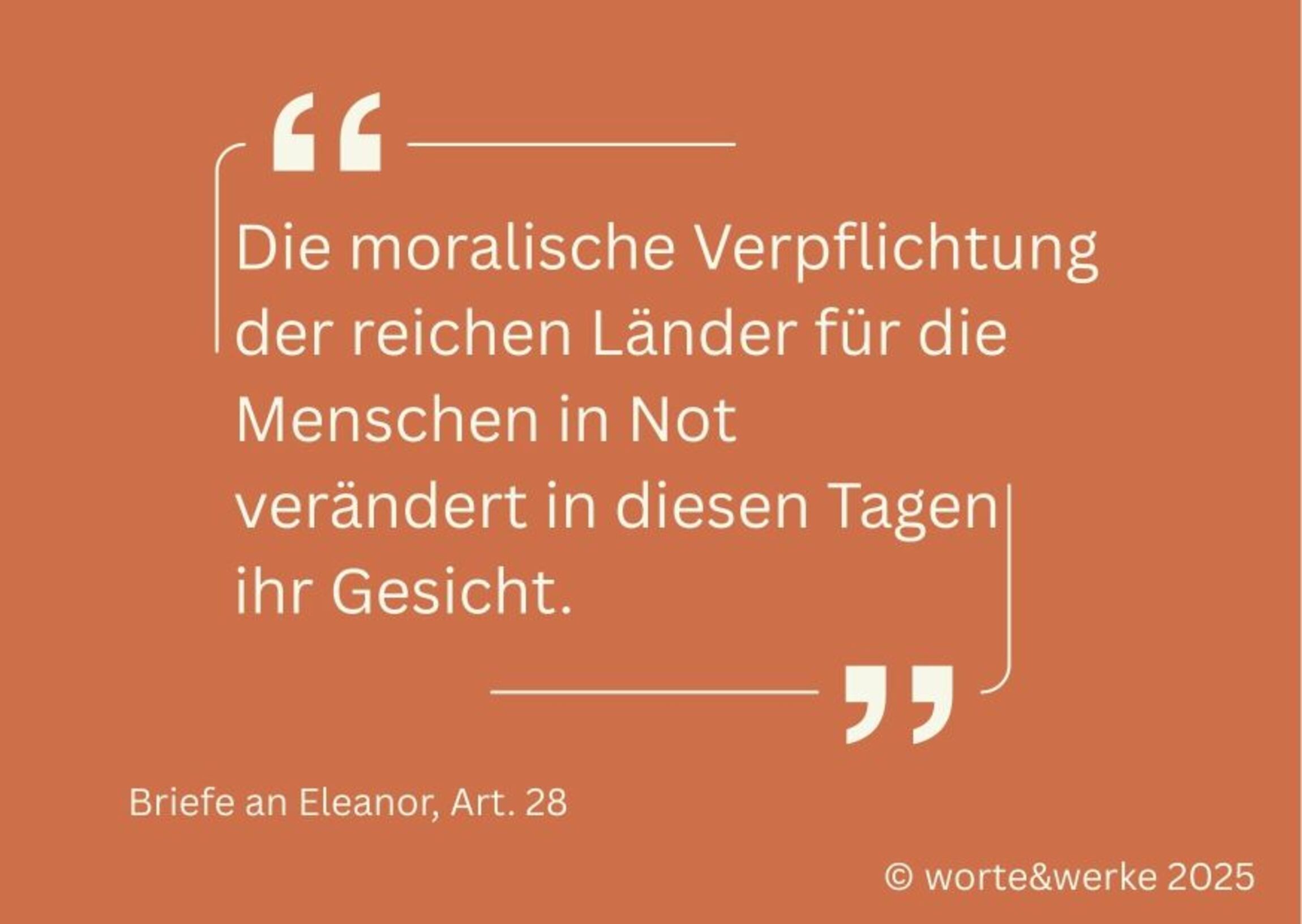
Sittensen, den 14.09.2025
Liebe Eleanor!
Über so Vieles habe ich Ihnen in den vergangenen Wochen geschrieben: Über das Recht auf Bildung, über das Wahlrecht, über die Unschuldsvermutung, über faire Gerichtsverhandlungen. Zwischendurch schwirrte mir der Kopf. Manche Nächte lag ich wach und konnte nicht gut wieder einschlafen.
Vielleicht lag es an dieser einen Beobachtung, die ich beim Nachdenken immer wieder machte und der ich hilflos gegenüberstehe. Das war die Feststellung, dass die Menschenrechte weltweit doch so oft mit den Füßen getreten werden. Dabei ist doch jedes Menschenrecht für sich ein Appell an unsere Menschlichkeit.
Ich stelle mir vor, wie Sie und Ihre Kommission mit den Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre in den Büros der Vereinten Nationen in der alten Flugzeugfabrik in Lake Success im Bundesstaat New York sitzen und miteinander beraten. Hier wollen Sie die universellen Werte vorbereiten. Und dann wird Ihnen deutlich, dass es ein Menschenrecht geben muss, das sich auch mit der internationalen Ordnung befasst. Eines, das über die nationale Ordnung hinausgeht. Sie debattieren die Chancen, die sich durch ein solches Recht eröffnen. Sie sprechen über die Verantwortung, die die reichen Länder gegenüber den ärmeren Ländern haben. Ein Recht auf soziale und internationale Ordnung ist das Ergebnis Ihrer Gespräche. Sie selbst Eleanor haben in Ihrem Einsatz für die Menschen, die dem grausamen Antisemitismus in Deutschland entflohen waren, genug schreckliche Biografien hören müssen. Nun suchten Sie Wege, Menschen eine neue Heimat zu ermöglichen. Wie dankbar bin ich für Ihr Engagement. Sie wussten, wir brauchen aufgrund der Erlebnisse der vergangenen Jahre internationale Institutionen, die sich darum kümmern, dass so etwas nie wieder passiert.
Als am 1. September 1948 in Paris auf einem Gebäude des „Palais de Chaillot“ die Fahne der Vereinten Nationen gehisst wurde, war das ein Zeichen für Verbundenheit für alle teilnehmenden Länder der dritten Generalversammlung der Vereinten Nationen. Ein Zeichen der Hoffnung, das in die Länder dieser Welt gesendet wurde. Es sollte zeigen: Wir stehen für einander ein. Wir tragen Verantwortung.
Und heute? Liebe Eleanor, ich nehme eine Rückwärtsbewegung wahr. Denn in diesem Jahr hat die amerikanische Regierung ihrer Entwicklungshilfe für ärmere Länder zum großen Teil eingestellt. Damit sind wichtige internationale Hilfsprogramme, viele Jahre mithilfe der amerikanischen Regierung ermöglicht, nicht mehr durchführbar. Das hat, wie Sie sich denken können, fatale Folgen für die, die diese Hilfe in den vergangenen Jahren dringend gebraucht und genutzt haben. Es ruckelt in der politischen Landschaft. Einige warten auf eine Art „Erdbeben“ und fürchten sich. Andere hoffen immer noch auf einen guten Ausgang der Gespräche zwischen den Regierungen. Während wir vor Jahren noch mit dem Satz „Schwerter zu Pflugscharen“ zum Frieden aufriefen, ändert sich jetzt der Ton. Die Rufe nach Waffen werden lauter. Ich habe selten in meinem Leben so viel über Legitimation von Waffen und Verteidigung durch Waffen gehört und gelesen. Ich habe keine Ahnung von Verteidigung, aber es macht mich traurig zu denken, dass es scheinbar keine anderen Verteidigungsstrategien geben soll.
Ich frage mich, wie es weitergehen soll. Wird das „europäische Haus“, das gerade ins Wanken kommt, zusammenbrechen oder wird es gut gestärkt aus dieser Situation hervorgehen? Was können wir tun, um Entwicklungsprogramme weiter zu unterstützen? Und wird es Lösungen für den Krieg in der Ukraine geben, von dem ich Ihnen erzählt habe?
Die moralische Verpflichtung der reichen Länder für die Menschen in Not ändert in diesen Tagen ihr Gesicht. Anstand und Moral scheinen in der Weltpolitik aktuell kaum noch eine Rolle zu spielen. Dort wo sie die eigene Agenda stören, werden sie bereitwillig geopfert.
Ich hoffe, dass der Menschenrechtspark, den wir in unserem Ort installieren, Leute ins Gespräch und ins Nachdenken bringt. Damit wir nicht aufhören, für diese moralische Verpflichtung, hier vor Ort, unsere Stimme zu erheben
Sie sehen mich trotzdem besorgt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 29
Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. Diese Rechte dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.
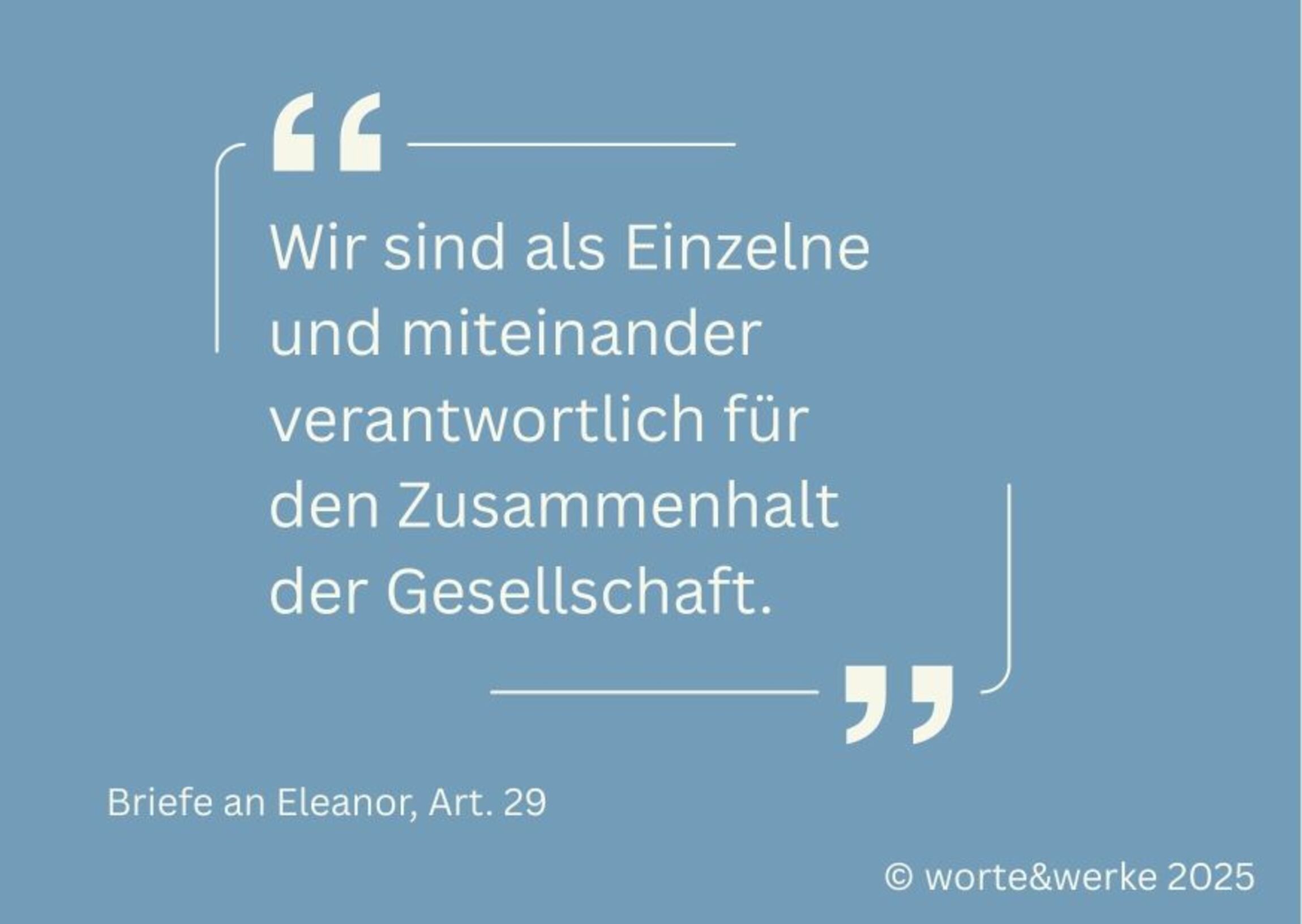
Sittensen, den 16.09.2025
Liebe Eleanor,
ich stelle mir gerade die Frage, ob Sie wohl das Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry gelesen haben. Dieses Buch ist mir nämlich sofort eingefallen, als ich Art. 29 der Menschenrechtserklärung gelesen habe.
„Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft.“
Pflichten zu haben, das bedeutet doch Verantwortung zu übernehmen. Und genau darum geht es doch auch in diesem kleinen Buch, das 1943 in New York erschien, weil der Verfasser dort im Exil lebte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie, liebe Eleanor, es nicht gelesen haben.
In dem Buch gibt es diesen Prinzen, der sich in eine Rose verliebt. Sie ist wunderschön, aber auch sehr anspruchsvoll und das bedrückt und verunsichert den kleinen Prinzen gleichermaßen. Er vertraut sich dem Fuchs an und spricht mit ihm über die Rose. Der Fuchs ist ein guter Berater und sagt dann zu dem kleinen Prinzen den oft zitierten Satz: „Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.“
Ich bin verantwortlich für das, was ich mir vertraut gemacht habe.
Sie waren verantwortlich, für das was Sie sich vertraut gemacht hatten.
Für den Prinzen war es die Rose. Und was, liebe Eleanor, war es für Ihre Zeit? Waren es die Schülerinnen ihrer Schule? Oder auch die Bauern, für die Sie die Fabrik gekauft haben?
Für meine Zeit erscheint mir die Antwort klar: Ich denke als erstes an die Menschen, die mir viel bedeuten. Meine Familie, meine Freund*innen. Die Menschen in meinem Dorf, in meiner Kirche. Dann denke ich an unser Land in dieser Zeit, an politische Entwicklungen. Ich denke daran, dass wir uns die Demokratie in diesen unruhigen Zeiten bewahren sollten. Wir sind einzeln und miteinander verantwortlich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Bewahrung der demokratischen Grundwerte. Wir sind verantwortlich für das, was wir uns vertraut gemacht haben.
Diese Verantwortung und Verbundenheit zeigt sich darin, dass wir als einzelne Person in der Gesellschaft nicht nur unsere Rechte wahrnehmen und einfordern dürfen, sondern auch zu unseren Pflichten stehen sollten. Eltern haben zum Beispiel eine Erziehungspflicht. In den eigenen vier Wänden und ab dem 6. Lebensjahr des Kindes müssen sie auch dafür sorgen, dass ein Kind zur Schule geht, denn es gibt eine Schulpflicht. Eine weitere Pflicht ist zum Beispiel die Steuer und Abgabepflicht. Da kann man schon mal tüchtig durchatmen, wenn das Finanzamt abbucht oder man auf seinen Lohnzettel schaut.
Liebe Eleanor, Sie werden mit mir übereinstimmen, dass Steuern nötig sind, weil sie unter anderem das Gemeinwohl unterstützen. Ich erspare Ihnen Daten, die sich sowieso von Jahr zu Jahr ändern. Mit unseren Steuern leistet jede*r auch einen Beitrag für die, die zu den Ärmsten und Schwächsten im Land gehören und die auf Unterstützung angewiesen sind. Manchen Zeitgenossen liegt diese solidarische Pflicht allerdings schwer im Magen. Manchmal würde ich gerne nachfragen, warum der Gedanke der „Solidargemeinschaft“ so schwer auszuhalten ist.
Es könnte dieser Konflikt sein, den Menschen in sich tragen: Die Frage danach, was wichtiger ist: Die/der Einzelne oder die Gemeinschaft? Vermutlich auch die Frage: Reicht das, was ich habe, für mich und meine Lieben. Ich persönlich kann diese philosophische Frage nicht detailliert beantworten, aber als Christin ist mir ein Satz von Jesus wichtig, den ich mir in Entscheidungen als Anregung zur Hilfe nehme: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
Dieser Satz beinhaltet doch, dass Gemeinschaft nur gelingen kann, wenn ein Mensch sich nicht selbst aus dem Blick verliert. Und wenn sich die einzelne Person nicht überfordert – denn das bedeutet doch Selbstliebe – kann aus einer Gemeinschaft etwas sehr Schönes entstehen. Dann wird sie tragfähig – auch für andere. Ist es nicht so, liebe Eleanor, dass Liebe so viel in uns verändern kann? Und ist es nicht so, dass sie manchmal mehr ermöglicht, als wir denken. Der Fuchs in der Erzählung vom kleinen Prinzen wusste etwas von diesem Geheimnis weiterzugeben.
Ich sehe es so: Wir alle, die ganze Weltgemeinschaft ist verantwortlich, für das was wir uns vertraut gemacht haben. Eine riesige Aufgabe, denke ich. Eine Aufgabe, für die es auch sehr viel Liebe und Empathie benötigt, damit sie den vielen Herausforderungen gewachsen ist. Gerade in dieser Zeit. Miteinander reden ist auch eine Pflicht. Gehört werden ist ein Menschenrecht. Sich über unterschiedliche Standpunkte auszutauschen ist manchmal schwer. Sie wissen, wovon ich spreche.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Liebe, die sich in Verantwortung für andere ausdrückt, eine große Wirkkraft hat.
In diesem Sinne herzliche Grüße
Ihre Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025
Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.
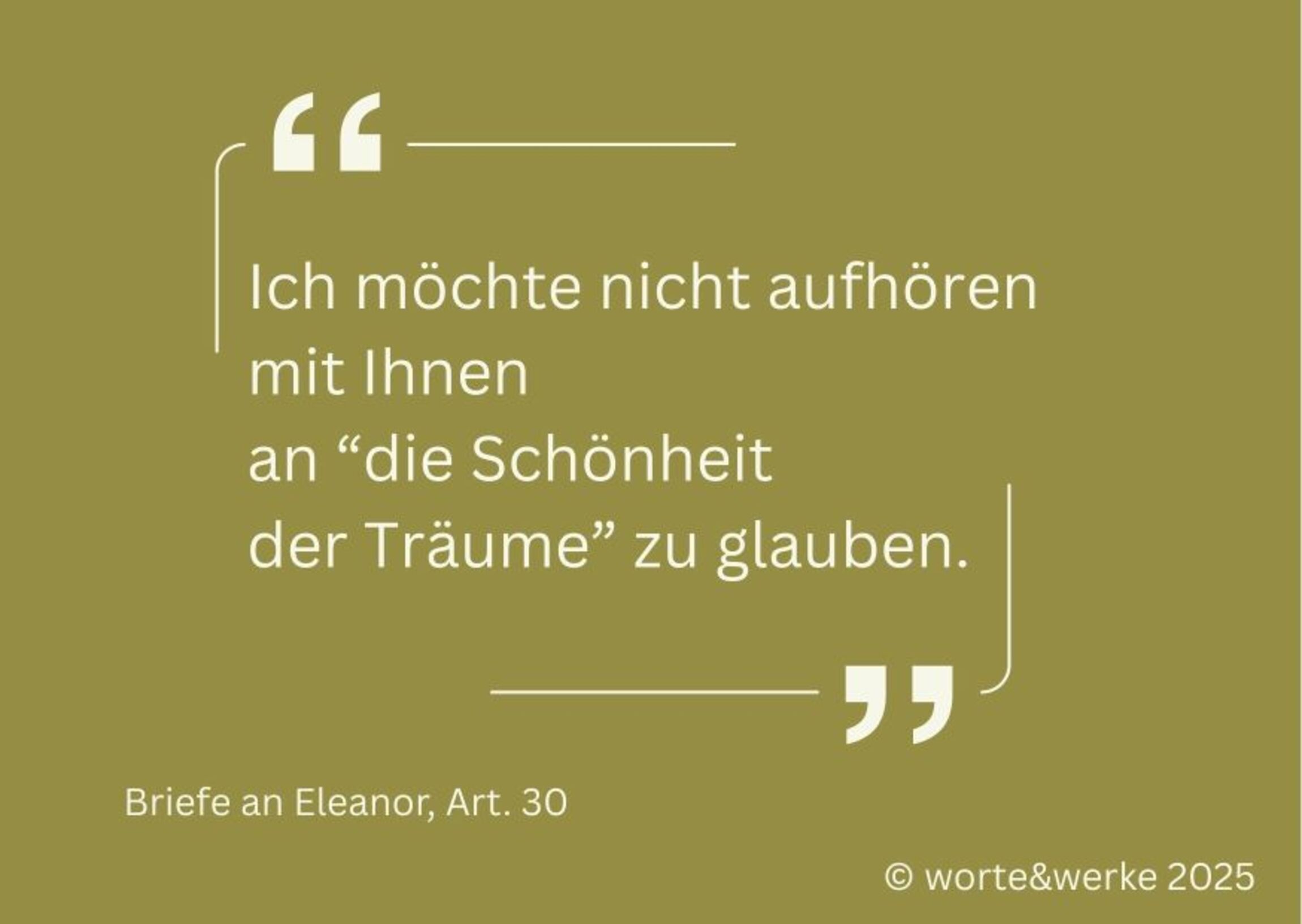
Sittensen, den 21.09.2025
Liebe Freundin!
Ja, liebe Eleanor, Sie sind mir in den letzten Wochen zur Freundin geworden. Dieser Brief ist der letzte von dreißig Briefen, die ich Ihnen in den vergangenen Wochen geschrieben habe. Mittlerweile ist es Herbst geworden. Die Blätter an den Bäumen tauschen ihr tiefes Sommergrün gegen goldgelbes Leuchten. Sie sollten sehen, wie schön es ist, wenn die Herbstsonne am Mittag durch die Blätter scheint. Ein wunderbares Lichtspiel, das bei mir vor dem langen norddeutschen Winter für gute Stimmung sorgt.
Ich habe noch einmal die letzten Briefe an Sie gelesen und bin voller Dank. So vieles haben Sie durch die Menschenrechte in meinem Kopf und Herz bewegt. Ich habe über so viele Themen nachgedacht und war sehr froh, dass ich meine Erkenntnisse und Fragen mit Ihnen teilen konnte.
Sie, liebe Eleanor erinnern sich sicher noch an Adlai Stevenson. Zweimal ist er zur Präsidentschaftswahl als Kandidat angetreten. Zweimal allerdings gescheitert. Das wird auch für Sie als seine Unterstützerin in diesem Unterfangen nicht einfach gewesen sein. So leicht gewinnt es sich in den 50ziger Jahren nicht gegen einen Dwight D. Eisenhower.
Mit Adlai hat Sie viel verbunden und er hat Sie sehr geschätzt. Bei ihrer Beisetzung soll er gesagt haben: „ Ich habe nicht nur eine gute Freundin verloren, sondern auch eine Inspiration. Sie hätte lieber eine Kerze angezündet, als die Dunkelheit verflucht.“
Was für berührende Worte anlässlich Ihrer Trauerfeier. So viel Respekt, Freundschaft und zugleich Ermutigung. Letzteres gilt bis heute. Ich fühle mich sehr bestärkt durch Ihre Persönlichkeit und die Arbeit der Kommission an den Menschenrechten. Ich fühle mich ermutigt jetzt aufzustehen. Nicht zu schweigen. Gerechtigkeit und Menschenwürde nicht nur zu leben, sondern sie auch für Benachteiligte einzufordern. Hinter allem Idealismus, der mich mit Ihnen verbindet, bin ich doch ähnlich wie Sie – Realistin genug, um zu erkennen: Es gibt an so vielen Stellen in der Welt Menschen in Regierungen und an anderen wichtigen Positionen, die versuchen werden, das Gute für Böses zu nutzen.
Vielleicht kennen Sie diesen Vers aus Römer 12: „Versucht nicht Böses mit Bösem zu besiegen. Besiegt stattdessen Böses mit Gutem.“ So verstehe ich auch diesen 30. Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Als Mahnung der Kommission nicht einen Satz aus dieser guten Erklärung zu nutzen, um das Gegenteil zu bewirken
Mir hat mal ein Freund in einer Situation gesagt: „Man glaubt gar nicht, wie Macht die Menschen verändert.“ Auch hinter diesem Satz verbirgt sich sehr viel Wahres. Ich frage mich, ob Macht aus Angst oder Überheblichkeit falsch genutzt wird. Denn eigentlich ist Macht eine Chance. Eine Chance Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu leben. Es ist doch so: Macht, die Gutes bewirken möchte, braucht immer zwei Korrektive. Von innen, z.B. das Gewissen und ein gutes Maß an Selbstreflexion und von außen Kontrolle und Gewaltenteilung.
Danke, deshalb, liebe Freundin, dass es diesen letzten Artikel in der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte gibt. Er hat etwas Bewahrendes. Damit nichts verloren geht, von all den wertvollen Artikeln, die in den 29. Artikeln zuvor aufgeschrieben wurden. Die Würde, die Freiheit, das Recht auf Bildung und auf soziale Sicherheit. Das Recht auf eine Internationale Ordnung und gerechte Wahlen. Das Recht auf Meinungsfreiheit und so vieles mehr.
Ich möchte nicht aufhören, zu denen zu gehören, die – so sagen Sie es – „an die Schönheit der Träume“ glauben. Damit reihen wir – Sie und ich – uns ein, zum Beispiel neben Martin Luther King jr. mit seiner bekannten Predigt „I Have a Dream.“ Ich träume auch diesen Traum für nachfolgende Generationen. Kinder und Enkelkinder. Die Kinder in meinem Dorf und überall in dieser Welt. Und sollte es anders kommen und diese Welt wieder einmal in Schutt und Asche fallen, werde ich hoffentlich gemeinsam mit anderen aufstehen, singen und glauben: „We shall overcome some day.“
Ich fühle mich sehr mit Ihnen verbunden, liebe Eleanor, und werde immer an Sie denken, wenn ich in meinem Dorf an dem kleinen Park unterhalb der St. Dionysius-Kirche die aufgestellten Tafeln mit den Menschenrechten lese.
Ihre Freundin Claudia M.
©edition worte&werke Sittensen 2025